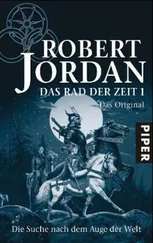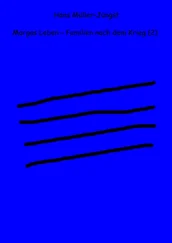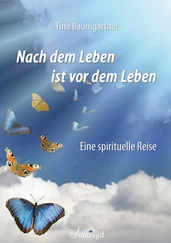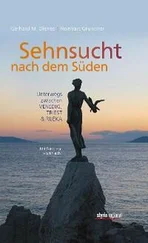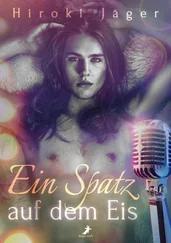Dabei war ein Doktortitel durchaus nicht immer Bestandteil meiner gewünschten Berufsbiografie. Ich hatte mein Studium bereits ein paar Jahre zuvor abgeschlossen und mit dem Diplom in der Tasche verschiedene Jobs angenommen. Kein Job konnte mich richtig begeistern. Allerdings hatte auch das Studium mich nicht richtig begeistert. Nach dem Abschluss hatte ich keine klare Vorstellung davon, wie mein weiteres Leben aussehen sollte. Ich probierte ein wenig herum, wurde aber immer mutloser. Diese Unzufriedenheit (sehr subjektiver Eindruck, viele, so auch meine Eltern, waren oder wären sehr zufrieden mit meinem geregelten Berufsleben) bekam hin und wieder energischen Rückenwind durch meine Oma. Ja, meine Oma.
Meine Oma verkörperte in etwa das Gegenteil von dem, was meine Eltern sich für meine berufliche Entwicklung gewünscht haben. Die Wünsche meiner Eltern tendierten zu einer soliden Ausbildung, gefolgt von einer gesicherten Anstellung innerhalb eines anerkannten Unternehmens. Obwohl ich die ersten sechs Lebensjahre überwiegend bei meiner Oma lebte, konnte ihre Lebensart nicht auf mich abfärben, leider wie sie sagte (zum Glück, wie meine Eltern dachten). Aus Sicht meiner Oma war ich genauso konventionell wie mein Vater, ihr Sohn. Bei ihm waren ihre Bemühungen umsonst gewesen. Bei mir hatte sie noch Hoffnung. Als ich später wieder bei meinen Eltern wohnte, blieb meine Oma trotzdem meine wichtigste Bezugsperson. Ich mochte ihre impulsive Art. Ihre Begeisterung war ansteckend. Sie versuchte immer wieder, mich aus dem geregelten Leben zu holen („Das kann warten, bis du alt bist.“). Am liebsten hätte sie mich in einer Zirkusgruppe in Südfrankreich gesehen oder zumindest als Lehrer im Tschad. Als sie hörte, dass ich mal in der Kletterhalle trainierte, mobilisierte sie bereits all ihre Kontakte, um mir eine Expedition ins Himalaja zu ermöglichen (und sie hatte Kontakte, ich musste tatsächlich zwei Anrufe tätigen, um das Vorhaben zu stoppen). Sie war es dann auch, die noch kurz vor ihrem Tod mich deutlich ermunterte, die Doktorstelle anzunehmen, zumindest eine Bewerbung abzugeben. Innerlich dürfte sie allerdings auch bei dieser beruflichen Ausrichtung geschaudert haben. Aber sicher war sie der Meinung, besser etwas Neues, als den gleichen Trott weiter zu machen. Oder sie hatte eine ihrer typischen Vorahnungen. Denn wenn ich alles zusammen betrachte, dann würde ich vermuten, dass mein Lebensabschnitt mit der Doktorarbeit genau nach ihrem Geschmack war. Obwohl oder gerade weil er sich ganz anders entwickelte, als ich angenommen hatte.
Ich hatte mich am Institut eingelebt und begeisterte mich langsam für das Thema meiner Arbeit. Eine notwendige Eigenschaft, wie Professor Oster, mein Betreuer, bemerkte. Als Doktorvater war er nicht unbedingt meine erste Wahl (falls ich ihn vorher schon gekannt hätte, hatte ich aber nicht) und seine cholerischen Anfälle hatten mir anfangs sehr zu schaffen gemacht. Aber er hatte auch ganz menschliche Momente. Ganz umgänglich. Sogar eher unkonventionell. Er kam aus Dresden. Dort hatte er eine Professur, bevor er nach Kiel kam. Im Grunde kamen wir beide gleichzeitig als die Neuen ans Institut. Eine Gemeinsamkeit, die uns verband, zart aber manchmal spürbar. Bei ihm zog sich der Abnabelungsprozess aus Dresden noch eine ganze Weile hin, sodass er zwischen Kiel und Dresden hin- und herpendelte. Dazu kam, dass er unzufrieden mit der Ausstattung seiner Kieler Büroräume war. Er konnte es durchsetzen, dass diese aufwendig renoviert wurden, bis er dort tatsächlich einzog. Das hatte zur Folge, dass er an seinen Kieler Tagen mein Büro belegte. Tage, an denen ich auf andere Räume oder die Bibliothek ausweichen musste. Es kam aber eher selten vor, meist ohne vorheriger Absprache oder Ankündigung.
Eine Nebenerscheinung der zunehmenden Identifikation mit der Forschung war die, dass ich mein bisheriges soziales Leben immer mehr vernachlässigte. Fuhr ich bisher immer mal wieder nach Lübeck, um Freunde oder meine Eltern zu besuchen, wurden jetzt diese Ausflüge seltener. Aus dem einfachen Grund, weil ich weniger Zeit hatte. Die Beschäftigung mit meiner Doktorarbeit erforderte mehr als einen acht Stunden Tag. Vielleicht auch, weil wir eher Ergebnis orientiert arbeiteten und sich Ergebnisse nicht automatisch nach acht Stunden Arbeitszeit einstellten. Dazu kam, dass es allen oder zumindest den meisten Doktoranden genauso erging. Aus dieser Schicksalsgemeinschaft heraus entwickelten sich schnell Freundschaften. Die wurden umso fester, je mehr Schicksal wir miteinander geteilt hatten. Und Gelegenheiten für größere und kleinere Schicksalsschläge gab es reichlich. Zu zwei Kollegen habe ich heute noch Kontakt. Aber davon später mehr. Fakt ist, dass auch unser soziales Leben immer mehr in der Forschungslandschaft verankert war.
Unser Institut war neben der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel eines der wenigen und wichtigen Forschungseinrichtungen Deutschlands, die sich mit Forschungsfragen aus dem angewandten Umweltbereich beschäftigten. Dem Bereich, dem ich wegen meines Forschungsthemas zugeordnet war. Und ein Bereich, der innerhalb des Institutes immer mehr Gewicht bekam. Aufgrund der Nähe zur Uni war der wissenschaftliche Austausch natürlich ausgeprägt. Aber dennoch war unser Institut bestrebt und allen voran der Dekan, in der Fachwelt für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, als die natürlich deutlich größere benachbarte Fakultät der Universität Kiel. Dies hatte zur Folge, dass unsere Arbeiten und Veröffentlichungen ein Niveau haben mussten, das meist über dem der vergleichbaren Arbeiten der Uni lagen. Ein Umstand, der zwar die Doktorandenzeit mühevoll machte, aber unter Umständen auch eher einen der begehrten Jobs in der Wirtschaft oder weiter in der Wissenschaft bringen konnte. Das jedenfalls war unser Trost, wenn die Kollegen von der Uni schon lange am Strand lagen oder Fußball spielten, während wir noch Daten analysierten oder Literatur wälzten.
Mein Mantel war schon etwas nass, als ich unser Institut erreicht hatte. Eine Treppe hoch, dann stand ich vor meiner Bürotür und mühte mich mit dem Schloss ab. Der hochgeschlagene, nasse Kragen klebte mir am Hals, ich hatte meinen Schal vergessen. Die Tür war nicht verschlossen. Ich trat ein und sah sofort, dass ich nicht allein war. Professor Osters Jacke lag quer über dem Schreibtisch. Gewachst, abgegriffen. Herr Oster selbst saß mit dem Rücken zu mir in seinem oder meinem Bürostuhl und starrte aus dem Fenster. Er hatte mein Eintreten nicht bemerkt. Durch seine eher zierliche Gestalt und der hohen Rücklehne lag sein Kopf entspannt auf der Nackenstütze. Bis auf den fast kahlen Schädel und seinem linken Ellenbogen auf der Armlehne, war von ihm wegen der Rückenlehne nichts zu sehen.
Er ließ sich durch mein Erscheinen nicht aus seiner Gedankenwelt holen. Obwohl ich diese Haltung von ihm schon kannte, irritierte es mich. Es war totenstill im Raum. Keiner rührte sich. Er starrte aus dem Fenster und ich wartete, dass er zum Ende damit kam. Dann erst registrierte ich das Chaos in meinem Büro. Einige Schubladen standen offen, viele Dinge lagen auf dem Boden verstreut herum. Ich begriff schnell, Oster hatte etwas gesucht aber nicht gefunden und hatte nun Mühe, einen cholerischen Anfall zu unterdrücken. In einer Animationsserie würden ihm jetzt Dampfwolken aus den Ohren pfeifen. Höchste Zeit für mich, den Raum geräuschlos zu verlassen. Was ich aber nicht tat. Die Wünsche eines Professors von dessen Augen abzulesen gehörte in den Bereich, den ich nicht gewillt war auszuführen, zumal er mir den Rücken zukehrte. Dann sollte er es schon sagen, wenn er ungestört bleiben wollte.
Ich missachtete also die aufsteigenden Dampfwölkchen und klopfte am Türrahmen. Dabei wünschte ich, so freundlich wie es mir gerade noch möglich war, einen guten Morgen. Sein Blick war starr auf das Fenster gerichtet, er ließ sich von mir in keiner Weise ablenken. Das Pfeifen der Dampfwolken war kaum noch zu überhören. Der Countdown hatte begonnen.
Читать дальше