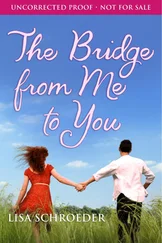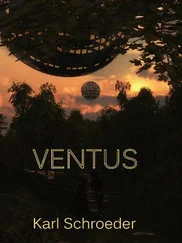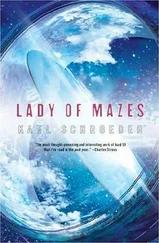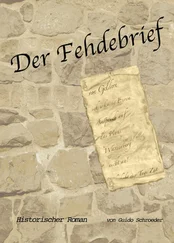„Bitte sag aber Oskar nichts davon“, flüsterte ich, als könnte er es hören. Ich hatte keine Angst vor ihm, nur Angst, dass er mich für einen dummen Schüler halten würde.
„Oskar, Oskar, was geht das Oskar an?“
„Er ist mein Vater“, sagte ich.
„Ach, du hast einen ganz anderen Vater. Das spielt jetzt keine Rolle. Du bleibst heute Nachmittag hier und wir üben Mathe!“
„Ich bin mit Albert zum Schwimmen verabredet!“
„Schwimmen? So lange du in Mathe schwimmst, schwimmst du mir nicht mit Albert. Pack dein Heft aus, wir üben!“
Sie brachte mir den Dreisatz bei, sie war ungewohnt geduldig. Ich versuchte zu folgen und war doch immer wieder abgelenkt.
„Was bedeutet: ich habe einen ganz anderen Vater?“
„Komm mal mit!“
Sie ging mit mir zum Radio, über dem Familienfotos hingen.
„Das ist Bela“, sagte sie und zeigte auf den dunkelhaarigen Mann links außen. Er ist Ungar, Kinderarzt, und ich habe ihn geliebt. Er ist dein Vater.“
„Und wo ist er jetzt?“
„Im Krieg vermisst, verschollen, wahrscheinlich tot. Ich weiß es nicht. Ich habe die Suche aufgegeben.“
„Oskar ist nicht mein Vater, nicht ein bisschen?“
„Oskar ist mehr. Oskar ist der, der für dich sorgt, der sich kümmert, dich beschützt. Oskar ist dein Freund.“
Tage später sprach Lehrer Fritz Mutter auf der Straße an: „Ihr Peter ist stinkend faul! Er wird die nächste Klasse auf keinen Fall schaffen!“
Mutter versprach ihm, noch mehr mit mir zu üben, fühlte aber seine feindliche Haltung und schlich ohne Widerworte mit ihrem Einkaufsnetz nach Hause, wo sie mit Oskar über alles redete.
Als der dem Lehrer das nächste Mal begegnete, sagte er freundlich: „Sollte mein Junge sitzen bleiben, stehst du auch nicht mehr auf!“
So hätte ich die nächste Klasse vielleicht auch erreicht, doch Lehrer Fritz empfahl der Mutter, mich in das 70 km entfernten Salesianer-Kloster zu schicken.
1955. Wir waren um die zwanzig Jungs im Kloster St. Immaculata. Alle spielten Fußball. Auch Tischtennis, Wett-rennen und Schwimmen standen hoch im Kurs.
Das Spektakel, das wir dabei veranstalteten, war weniger Begleiterscheinung des jugendlichen Kräftemessens als der Versuch, die Mädchen aufmerksam zu machen. Die lebten im Nebengebäude. Hinter der hohen Hecke konnten wir sie nicht sehen, aber hören – wie sie uns.
Findige wussten bald Namen und Besonderheiten einzelner Mädchen. Es gab die mit der Prinz-Eisenherz-Frisur oder die mit dem schrillen Lachen. Und es gab Sonja.
„Sonja reibt ihre Titten mit Nivea ein, das sind richtige Puddingbällchen“, sagte Ludwig. „Haste so was schon mal angefasst?“
Hatte ich nicht. Ich brabbelte irgendwas, und er gab Ruhe. Im Kloster verging kein Tag ohne anzügliche Bemerkungen, kein Spiel ohne genitale Schäkereien, keine Nacht ohne „unkeusche“ Experimente.
Reizender als Sonjas Brüste fand ich die Beine der Zwillinge Christian und Friedrich von Brunkwitz. Bei Versteckspielen kauerte ich manchmal neben einem von ihnen. Knie an Knie, Auge in Auge, Mund auf Mund. Wie einfach das ging, erstaunt mich noch heute.
In aller Öffentlichkeit verabredeten wir uns zu einer abendlichen Übung auf dem Dachboden. Wir, das war unsere Schlafzimmergemeinschaft: sieben Jungen zwischen zwölf und vierzehn. Thema: „Wie küssen Männer richtig?“
Mit gestreckten Armen stellten wir uns vis à vis auf. Nächster Schritt: Umarmung. Die geriet ungelenk, wenn beide ihre Köpfe zur gleichen Seite neigten.
Ohr an Ohr. So kann man nicht küssen.
Nächster Schritt: Lippen aufeinander.
Lippen aufeinander? Richtige Männer küssen anders. Lippen auseinander. Zunge an Zunge.
Zunge an Zunge? Das ist es auch noch nicht. Zunge rein in den anderen Mund. Saugen.
Das soll es sein?
Mich turnte es nicht an. Meine Lust erwachte, wenn ich neben Christian im Bett lag und seine Beinbehaarung spürte. Die Kuss-Übung wurde Pflicht, die ich absolvierte, um die Kür im Bett zu verdienen.
Meine Lust auf Jungen hielt auch am Tage an, wenn die der anderen den Mädchen zuflog. Mit leuchtenden Augen sprachen sie von Sonja. Alle wollten sie. Alle, außer mir.
Ob die Ordensschwestern das ahnten? Jedenfalls fiel ihre Wahl auf mich, als die männliche Hauptrolle in einem Kreuzritter-Stück besetzt werden sollte. Das Burgfräulein, das ich verteidigen und am Ende küssen musste, spielte Sonja. Ich hatte vor ihr zu knien und sie anzuhimmeln. Knien war kein Problem, meine Knie waren verhornt vom Beten, doch die Rolle war mir fremd. Um durchzuhalten, stellte ich mir vor, dass mein Burgfräulein nicht Sonja, sondern Christian hieß.
In Gedanken kniete ich vor ihm.
Jesus legt den Arm um Johannes. Der schmiegt den Kopf an Jesus‘ Schulter. Das Gemälde, an dem ich täglich auf dem Weg zur Messe vorbeikam wurde mein Sinnbild für Geborgenheit, Zuneigung und Zärtlichkeit. Wie gut, wie sicher musste sich Johannes fühlen. Wie sehnte ich mich nach Schutz, nach Verlässlichkeit und Wärme. Keine Schulter, an der ich lehnen konnte. Keine Arme, die mich hielten. Weggegeben, weitergereicht, herumgestoßen, so schien mir mein Leben bisher. Im Kloster setzte es sich fort. „Fasst Euch nicht an!“, keiften die Nonnen, wenn sie entdeckten, dass ein Junge seinen Arm um die Schulter eines anderen legte. Körperliche Nähe war verpönt. Selbst den eigenen Leib durften wir kaum berühren, den Schwanz nur zum Pinkeln.
Manchmal saß ich still in irgendeiner Ecke und träumte. Es geschah auch, dass ich während des Unterrichts meinen Kopf auf die Schulbank legte, die Augen schloss und mir vorstellte, sie wäre eine Schulter. In solche Tagträume fielen Erinnerungen an Oskar: wie er mich auf seinen Schultern trug, mit mir über Gräben sprang und Bäche. Das war wie Schaukeln auf See, wie Fliegen mit sicherem Halt. Nur einmal bekam ich Angst. Als er mit mir herumtollte und seine Schäferhündin an uns hochsprang.
„Sie will nur spielen“, beruhigte er mich. Ich begann laut zu lachen. Das war Mimikry. Lachen, um nicht zu schreien. Ob Oskar das durchschaute, als ich meine Arme fester um seinen Hals klammerte?
Neben dem Hang zum Grübeln, Stillsitzen und Träumen hatte ich oft Lust auf Bewegung, auf Kontakt mit den anderen. Beim Schwimmen, Tischtennis spielen, sogar beim Fußball tobte ich mich aus, rempelte und bolzte mit den Jungs – und keine schrillen Stimmen untersagten die Berührung.
Privatstunden im Kuhstall
Für meine zwölf Jahre war ich zu schmächtig. Jeden Mittag verabreichte die Kinderschwester mir einen Löffel Lebertran.
In der hinteren Ecke ihrer Zelle lehnte ein Akkordeon. Immer an der gleichen Stelle, als würde es nie angerührt. Sie bemerkte meinen interessierten Blick und fragte: „Bist du musikalisch?“
Bin ich musikalisch? Lauter als gewollt antwortete ich: „Mutter sagt, Musik liegt mir im Blut.“
„Ach“, scherzte sie, „und wie kam sie dort hinein?“
„Mutter sagt, Oma spielte Klavier und Opa trällerte Arien mit schönem Tremolo, beim Baden … und selber sang sie auch oft, beim Putzen.“
„Und du, spielst du ein Instrument?“
„Nein.“
„Möchtest du es lernen?“
„Ja.“
„Stallknecht Leo spielt Akkordeon. Ich werde ihn fragen, ob er es dir beibringt.
Leo war bereit, mich zu unterrichten. Mutter war bereit, dafür drei Mark pro Stunde zu bezahlen. Die Schwester schenkte mir das Akkordeon.
An einem Sonntagvormittag sollte ich meinen ersten Unterricht erhalten. Sonntagvormittag? Der war für den Gottesdienst reserviert. Nicht der ganze, Gott sei Dank. Beladen mit dem Instrument stand ich nach absolvierter Andacht vor der Tür der Klosterknechte. Ich klopfte schüchtern.
Читать дальше