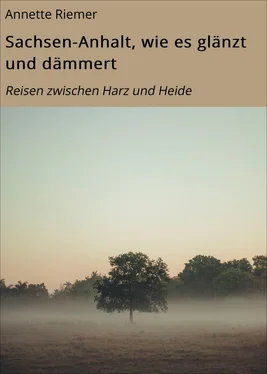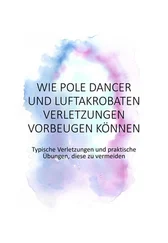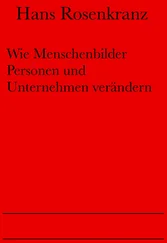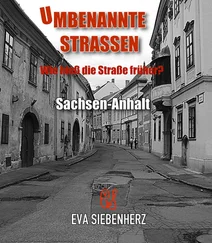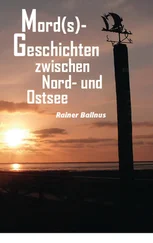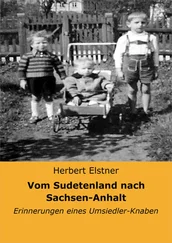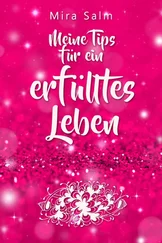Annette Riemer - Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert
Здесь есть возможность читать онлайн «Annette Riemer - Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
"Wer nach der Lektüre dieser entzückenden kleinen Schlaglichter Sachsen-Anhalt noch immer nicht liebgewonnen hat, der hat ein Herz aus Scheiße." Joseph Wälzholz (Die Welt)
Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Biederitz erleidet dasselbe Schicksal wie die anderen beiden Einheitsgemeinden des Jerichower Landes, Elbe-Parey und Möser: Sie stehen hinter der fünf Städten Burg, Genthin, Gommern, Jerichow und Möckern zurück und sind noch gesichtsloser als diese. Weil sie zusammengeschustert worden sind, künstliche Gewächse. Aber auch, weil da eben nicht viel ist auf dem platten Land Ostelbiens: Dorfkerne und Wohnparks, alte, gewundene und am Reißbrett entworfene Straßenzüge eng beieinander.
Immerhin, man bemüht sich. In Biederitz etwa, genauer gesagt im Ortsteil Heyrothsberge, wird ein alter NVA-Bunker als Konzertbühne und Bar genutzt. Das ansehnlichere Schloss Neu Königsborn hingegen verfällt. In Möser befindet sich neben einer Bockwindmühle, einem Hünengrab und einem Weinberg ein ziemlich imposantes Wasserstraßenkreuz, wo die Elbe den Mittellandkanal passiert. Und in Elbe-Parey? Na, alle sieben Dörfer der Gemeinde von Bergzow bis Zerben haben kleine, niedliche Dorfkirchen vorzuweisen. Es muss ja nicht immer Berlin sein. Und auf dem teilsanierten Schloss Zerben lebte einst das leibhaftige Vorbild für Theodor Fontanes Effi Briest – also doch ein bisschen Berlin und Preußen.
Und dann schwebt seit einigen Jahren die jährlich gekürte Elbauenkönigin durch alle Bierzelte der am dünnsten besiedelten Gemeinde des Landkreises. Das hat schon was, das verleiht Kultur, wenngleich auch eher Agri-Kultur. Denn Elbe-Parey ist wie alle anderen Gemeinden im Landkreis auch hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt. Der Tourismus hingegen beschränkt sich auf den Verkehr: Die Radfahrer ziehen langsamer, die Zugreisenden (meist) schneller durch das Land. Und länger als für eine Nacht, so versichert der Gastwirt in Biederitz, ist hier noch niemand abgestiegen. Wozu auch, fragt er.
Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld – das gibt es ja heute gar nicht mehr. Seit 2007 ist die einstige Boomtown der DDR Teil von Bitterfeld-Wolfen. Seitdem gibt es auch keinen Landkreis Bitterfeld mehr, nur noch Anhalt-Bitterfeld. Dabei lag Bitterfeld nie im historischen Anhalt, nur an der Bitter, wie Kurt Tucholsky in seinem Schloss Gripsholm erzählt. Aber davon wissen nicht einmal die Bitterfelder: Einen Fluss namens Bitter gibt es nicht.
Es stimmt schon etwas traurig, durch diesen Ort zu schlendern. Eigentlich müsste es hier doch aufwärts gehen: Neuer Name, neues Glück. Und ein neues Image: Früher galt Bitterfeld als chemisches Drecksloch, aber inzwischen sind alle Akten ausgewertet: Der verseuchteste Ort der DDR war Merseburg, nicht das verkannte Bitterfeld. Dazu ein architektonisch bemerkenswerter Bitterfelder Bogen statt eines Bitterfelder Wegs in den literarischen Sozialismus. Statt Tagebau heißt es jetzt Seenlandschaft.
Und trotzdem: Das Rathaus in seinem voluminösen Gute-Hitlerjahre-Stil, der Kulturpalast im sozialistischen Betonformat und nicht zuletzt die Glasfronten der neuen Berufsschule – weithin sichtbar – hauchen Bitterfeld etwas martialisch Übergroßes ein. Das Flair fehlt.
Und auch ein bisschen die Einwohner. Die Stadt hat sich seit der Wende fast halbiert. Und wer in einer ehemals boomenden Arbeiterstadt ohne großartiges Bildungsbürgertum nach der Abwanderung der „gut ausgebildeten, meist weiblichen jungen Menschen“ geblieben ist, kann sich wohl jeder denken. Wer nicht, muss nur am Sonntagnachmittag an die Goitzsche raus. Solche derben O-Töne bekommt man sonst nur in Halle-Neustadt zu hören.
Also gar keine Hoffnung für Bitterfeld? Vielleicht mit Blick auf das Europagymnasium in der Binnengärtenstraße, vielleicht vor dem alten, backsteinernen Rathaus am Markt, in den vielen, teils neu angelegten Parks – da ist die Stadt dann doch überraschenderweise – beinah schön.
Blankenburg
Blankenburg ist etwas für den Nachmittag. Vorher sollte man nicht in diese kleine Stadt am Nordrand vom Harz fahren, denn um den Mittagstisch ist es hier schlecht bestellt: Die meisten Restaurants haben Mittagsruhe. Aber an diesem einen Nachmittag lässt es sich gut durch die weitläufige Ortschaft und ihre gewundenen, stark ansteigenden Straßen flanieren.
Was gibt es zu sehen? Ein imposantes Rathaus, ein kleines Barockschlösschen nebst symmetrisch angelegtem Garten – und dann einen altersschwachen Kasten, der als größtes deutsches Welfenschloss firmiert. Der Aufstieg zu dieser ehemaligen Residenz führt an verfallenen Nebengebäuden vorbei. Oben kann man sich den Wanderpass abstempeln lassen – zur Selbstbestätigung einer sportlichen Leistung, die keine ist, denn das Schloss auf seinen gerade einmal 300 Höhenmetern ist sehr gemütlich zu erreichen.
Oben dann ein Innenhof, davor ein Ausblick auf niedrigere und höhere Berge, darin ein Café, das zwei Stunden pro Woche (samstags) geöffnet hat. Ansonsten der Muff vergangener Epochen. Von den Welfen bleibt hier nur die Gewissheit, dass ihre Zeit schon lange her ist.
Im Teehaus gibt es Kaffee, in der oberen Mühle Bier, aber sonst ist Blankenburg ziemlich sonntagsträge. Die leeren Geschäfte deuten an, dass es hier auch werktags nicht sonderlich belebter zugeht. Dass es mit Blankenburg eher ab- als aufwärts geht, verrät schon ein Schild am Bahnhof, das warnt: «Auf diesem Bahnhof ist jetzt kein Aufsichtsbeamter mehr. Sorge bitte selbst für Deine eigene Sicherheit!»
Die Stadt hat eben das Pech, in einer ziemlich prominenten Nachbarschaft zu liegen: Halberstadt hat die besseren Museen, Wernigerode das bekanntere Rathaus und ein restauriertes Schloss, Thale hat die schönere Umgebung mit Rosstrappe und Hexentanzplatz und Quedlinburg ist überhaupt ein einziges Flächendenkmal.
Trotzdem lohnt sich ein Abstecher nach Blankenburg. Zum einen ist es – gerade weil so unspektakulär – tatsächlich ein Erholungsort. Hier zieht nichts ernsthaft an den Nerven, die Seele kann sich entspannen. Zum anderen gibt es etwas nördlich der Stadt die Reste der Burg Regenstein zu besichtigen. Diese hochmittelalterliche Festung wurde in den Felsen gebaut. Man wandelt durch künstliche Höhlen, die ineinander übergehen und von denen heute niemand mehr weiß, was Kapelle, was Rittersaal, was Schlafgemach war. Hier darf man träumen von alten Geschichten, die man aus Kinderbüchern kennt. Hier spuken die Harzer Sagen um Teufel und Düsternis. Hier ist Blankenburg geradezu märchenhaft.
Braunsbedra
Diese Stadt ist ganz düster. Seit knapp zwanzig Jahren gibt es sie inzwischen, durch zahlreiche Eingemeindungen der nicht weggebaggerten Tagebausiedlungen ist sie auf knapp 11.000 Einwohner gewachsen und erstreckt sich um den östlichen Teil des Geiseltalsees, dieses größten künstlichen Sees Deutschlands, der jetzt Naherholungsgebiet werden soll. Für Braunsbedra springt dabei ein Hafen heraus, neue Siedlungen sollen entstehen und durch den Zuzug finanzkräftiger Neubürger wird dann die ganze Wirtschaft hier unten im Saalekreis explodieren. Ganz bestimmt.
Aber der Boom boomt in Zeitlupe. Die meisten Siedler, die sich ein Häuschen mit Seeblick kreditfinanziert errichten, kommen aus Braunsbedra selbst, sind den ewiggleichen Platten entflohen, die sich über die ganze Stadt verteilen. Dort, zwischen den drei- und vierstöckigen Häuserzeilen, wo hinter jedem Fenster eine Kummeroma sitzt und in jeder Tür eine rauchende Jogginghose steht – da ist es richtig finster, da boomt überhaupt nichts.
Auch das Stadtzentrum scheint mehr auf Verfall als auf Aufschwung eingerichtet zu sein. Am Marktplatz, der eigentlich gar kein Platz ist, sondern von einer zweistöckigen Passage überdeckt wird, sitzen der Optiker und der Bestatter, die Kurzzeitpflege und die Tagespflege, das Rathaus direkt gegenüber der Fußpflege. Im einzigen Café im Karree heißt die Kellnerin „Garmen“ und wird von jedermann geduzt, auch von den beiden Polizistinnen, die bei ihr mit „Ma‘ ma‘ ein Eis“ den drögen Dienst auflockern. Und die trotz gefunktem Einsatzkommando warten, bis „Garmen“ beide Portionen zurechtdrapiert hat. „Nee, bei mir keene Sahne, die jehd jleich off de Hüfde“, sagt die dünnere Polizistin noch, dann trotten sie gemütlich Richtung Einsatzwagen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Sachsen-Anhalt, wie es glänzt und dämmert» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.