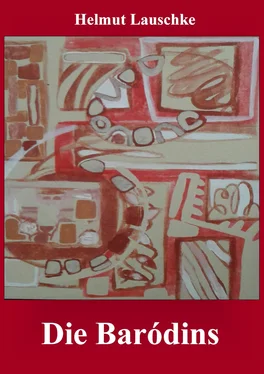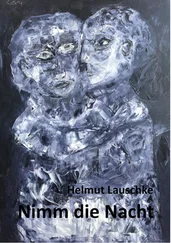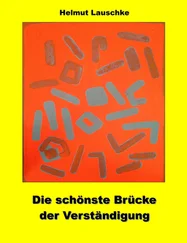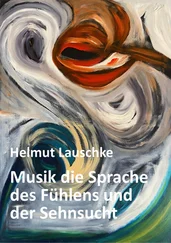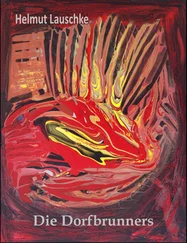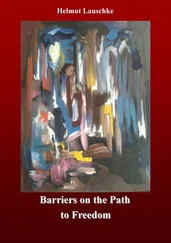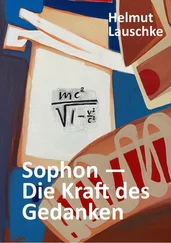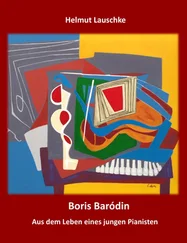Frau Grosz: “Herr Baródin, weil Sie durch den slawischen Teil in ihrem Blut auch slawisch fühlen. Das ist für mich ganz offensichtlich. Dabei muss ich gestehen, dass auch mich dieses >Andante< zutiefst erschüttert. Da ist es keine Schwäche, wenn die Tränen in die Augen steigen. Es ist die Teilnahme am Schicksal der Menschen, unter denen es so viel Leid und Trauer gibt.” Boris: “Darf ich Sie fragen, wer die beiden Männer auf den Fotos sind?” Frau Grosz: “Der eine war mein Mann, der Geiger in der Wiener Philharmonie war und mit anderen Orchestermitgliedern nach Ausschwitz deportiert und vergast wurde; der andere war mein Sohn, der bei den Straßenkämpfen in Warschau von den Deutschen erschossen wurde. Er wollte Medizin studieren, war sehr musikalisch und sprach fünf Sprachen.” Boris: “Ich darf ihnen nachträglich mein tiefempfundenes Beileid ausdrücken.” Frau Grosz: “Das ist sehr lieb von Ihnen. Das ist mein Schicksal, mit dem ich fertig werden muss, aber nicht fertig werde. Es waren zwei Männer von hoher Intelligenz und großer Fürsorglichkeit. Mein Mann war polnischer Jude, mein Sohn ein halbjüdischer Patriot, der überhaupt nicht zögerte, sein Leben für die Befreiung Warschaus einzusetzen, das er schließlich auch ganz hingegeben hat.” Boris: “Das sind erschütternde Geschichten, die Sie mit sich tragen.” Frau Grosz: “Wissen Sie, Herbert von Karajan leitete die Wiener Philharmonie. Aber er war ausschließlich auf seine Karriere bedacht. Er war ein frühes Mitglied der Nazipartei in Österreich und nach dem “Anschluss” 1938 gleich auch Mitglied der deutschen Nazipartei. Der hat sich nicht für seine jüdischen Orchestermitglieder eingesetzt, hat nicht um ihr Leben gekämpft. Er war kein Furtwängler, der die Nazis verabscheute, persönlich bei Goebbels vorstellig wurde und um das Leben der Mitglieder der Berliner Philharmonie kämpfte.” Boris: “Leider hat auch dieser große, hagere Mann nicht alle aus seinem Ensemble retten können.” Frau Grosz: “Aber er hat es versucht und dabei sein Leben riskiert, was Karajan nie getan hat. Wissen Sie, Herr Baródin, für mich sind die Deutschen ein Rätsel geblieben. Sie sind gebildet und fleißig, haben einen Bach, Beethoven, Brahms, einen Goethe, Schiller und Lessing hervorgebracht, aber den “Faust”, “Die Glocke”und den “Nathan der Weise” haben sie nicht verstanden. Nehmen Sie die Ringparabel im Nathan. Sie ist ein Vermächtnis zur Toleranz und Gerechtigkeit.” Boris: “Ich habe den Nathan in der Schule gelesen. Er war sogar ein Aufsatzthema. Soweit ich mich erinnere, hatte der Vater seinen Ring kopieren lassen und kurz vor seinem Tod jedem Sohn einen Ring gegeben. Nun erhob jeder Sohn seinen Anspruch auf den Titel und hinterlassenen Besitz des Vaters, da er seinen Ring geerbt hatte. Doch Vater’s Ring, der Musterring, war von den Kopien nicht zu unterscheiden.” Frau Grosz: “Nun kommt die Pointe zur Frage, wer im Recht ist. Nathan sagt, der rechte Ring ist nicht erweislich, fast so unerweislich wie der rechte Glaube ist. Der Vater hat die Kopien in der Absicht machen lassen, dass die Ringe nicht zu unterscheiden sind. Das ist doch die Lehre, die wir aus dem Nathan zu ziehen haben: Das Üben in der Toleranz und im Großmut. Da hat sich die Hybris der Nazis schwer vergriffen, als gäbe es nur die Deutschen, die eine Kultur und den richtigen “Glauben” haben.” Boris: “Für die Fehler und Fehleinschätzungen ist das deutsche Volk doch schwer genug bestraft worden. Stimmen Sie mir da zu, Frau Grosz?” Frau Grosz: “Da stimme ich Ihnen völlig zu, denn viele gute Deutsche hat es ja auch fürchterlich getroffen. Nun soll das neue Kapitel unserer Völker geschrieben werden. Deshalb sind Sie hier, um mit dem Brahms-Konzert zur Verständigung und Aussöhnung unserer Völker beizutragen.”
Frau Grosz goss den Tee nach: “Das ist eine verantwortungsvolle, antwortschwere, aber ehrenwerte Aufgabe im Sinne des Vermächtnisses des ‘Nathan des Weisen’, die auf Sie wie auf die Künstler unserer beiden Völker im Allgemeinen zukommt. Kennen Sie die Vorgeschichte des ‘Nathan’?” Boris: “Nein, die kenne ich nicht.” Frau Grosz: “Lessing war als Bibliothekar der Wolfenbütteler Bibliothek mit dem hamburgischen Hauptpastor Goeze in einen literarisch-theologischen Streit geraten. Der Streit ging um die Freiheit der Forschung in religiösen Fragen, der so viel Aufsehen erregte, dass der Bibliothek im Juli 1778 durch Kabinettsbeschluss weitere Veröffentlichungen untersagt wurden. Durch diesen Beschluss ließ sich Lessing aber nicht mundtot machen. Er verfasste den Nathan und hoffte, den Theologen einen “ärgeren Possen” –so schrieb es Lessing am 11. August 1778 an seinen Bruder Karl – zu spielen als mit den zuvor verfassten zehn Fragmenten, die den Streit auslösten. In seinem Brief vom 6. September 1778 an Elise Reimarus schrieb Lessing, dass er versuche, wenigstens auf seiner alten Kanzel, dem Theater, noch ungestört “predigen” zu können. Die Quelle zum Nathan war eine Novelle aus dem ‘Decamerone’ von Giovanni Boccaccio ( 1313-1375 ). Eine Aufführung des ‘Nathan’ hat Lessing nicht erlebt. Erst nach einer Bearbeitung von Schiller wurde der Nathan am 28. November 1891 in Weimar uraufgeführt.” Boris: “Das ist sehr interessant, und ich bewundere ihr Wissen um den Nathan.” Frau Grosz: “Der ‘Nathan’ wurde von Lessing deutsch geschrieben, der zur Weltliteratur gehört, weil er die Fragen der Freiheit und Toleranz behandelt. Wir Polen lieben und verehren den ‘Nathan’. Ich habe ihn als Mädchen in der Schule in der Originalfassung gelesen. Später habe ich den Nathan in den verschiedensten Sprachen auf der Bühne erlebt. Von Goethe, der den ‘Nathan’ verehrte, stammt der Satz: “Möge das im Nathan ausgesprochene göttliche Duldungs- und Schonungsgefühl der Nation heilig und wert bleiben!” Da spricht doch die große Kultur zu uns.” Boris: “Ja, ich verstehe Sie. Darum müssen wir die schlimme Vergangenheit abschließen und den Neuanfang wagen. Wir müssen die Aufgabe der Verzeihung und Aussöhnung annehmen und unseren Beitrag kraftvoll dazu leisten, damit das Kapitel des unsäglichen Leides ein für allemal abgeschlossen ist.” Frau Grosz: “Nach diesem Gespräch freue ich mich noch mehr auf ihr Konzert, zu dessen Gelingen ich Ihnen die Daumen drücke.” Frau Grosz brachte Boris an die Tür und bedankte sich dort noch einmal für das Gespräch.
Es war dunkel geworden, als Boris die Pesulski Straße in Richtung Hotel ging. Für ihn war es ein gehaltvolles Gespräch. Er war ergriffen von der Geschichte ihres Mannes und des Sohnes, war verwundert über das literarische Wissen, das Frau Grosz über den ‘Nathan’ parat hatte. Er betrat das Hotel und war noch an der Eingangstür, als ihm der junge Mann an der Rezeption zuwinkte: “Ich habe ein Gespräch aus Deutschland für Sie. Es ist ihre Mutter, die schon einmal angerufen hatte. Soll ich das Gespräch auf ihr Zimmer durchstellen?” “Bitte tun Sie das.” Boris nahm hastig die Stufen zu seinem Zimmer Nummer 7 im ersten Stock. Er hörte das Telefon klingeln, als er dabei war, die Tür aufzuschließen. Er schloss die Tür und eilte zum Telefon. Es war die Mutter, die aus Hamburg-Blankenese anrief: “Da bekomme ich die endlich. Ich habe schon einmal angerufen. Da wurde mir gesagt, dass du nicht im Hotel seist. Wie war die Probe? Ich habe viel an dich gedacht.” Boris: “Es hat gut geklappt. Die Warschauer Philharmonie ist ein großartiger Klangkörper. Es hat Freude gemacht, mit diesen Musikern Brahms zu spielen.” Mutter: “Es muss ja sehr gut gewesen sein, denn deine Stimme klingt ja so gelöst und heiter. Ist dein Vortrag so gut angekommen? Ja das ist er. Der Dirigent war von meinem Spiel begeistert und sagte, dass er durch mein Spiel Brahms erneut lieben gelernt hätte. Dafür bedankte er sich besonders.”
Читать дальше