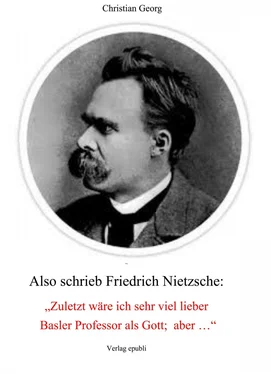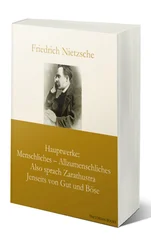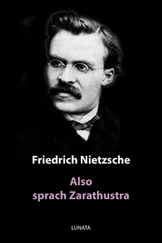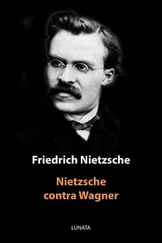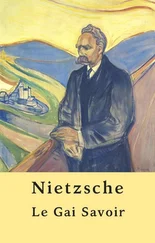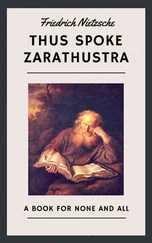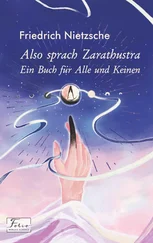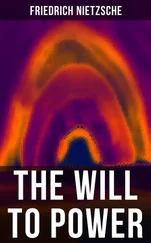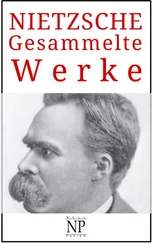Außerdem folgen noch zwei Lieder, das erste eine Probe meiner Kirchenlieder, ein Genre, dessen Pflege sie [eigentlich wohl „Sie“?] bei mir schwerlich vermutet - und das andre, ein Stückchen Selbsterlebnis, wenn Sie’s glauben, worüber Sie - Dank ihrem natürlichen Geschmack - ein Gelächter erheben werden. Sonst verbleibe ich bis auf ein baldig Wiedersehen [in Pforta, zum kommenden Ferienende?] FWvNietzky (alias Muck) homme édtudié en lettres (votre ami san[s] lettres) (324)
Die letzten Worte dieses Briefes bedürfen einer nicht ganz einfach zu gebenden Erläuterung: Da ist erst einmal bedenkenswert, dass N sich bereits als Pfortaer Schüler dem Schulkameraden gegenüber mit einem angeblich wohl polnischen „Adelsnamen“ schmückte, den es laut dem polnischen Adelslexikon überhaupt nicht gab J1.27. 20 Jahre später, 1882, kam N auf diesen Namen zurück, nachdem er im August 1880 in stimmungsmäßig äußerst verwirrten und verwirrenden Umständen auf die unhaltbare „Wahrheit“ gebracht worden war, dass er, allein aufgrund seines Aussehens, von polnischen Edelleuten abstammen sollte. Davon zu gegebener Zeit mehr. Das „(alias Muck)“ ist ein Hinweis auf einen Übernamen, auf einen „Jemand“, der N neben seiner Pfortaer Schülerexistenz auch ist . Wer aber könnte „Muck“ sein? Gegoogelt ergibt „Muck“ seitenlang nichts als Zusammenhänge mit übelriechenden Düngemitteln.
Wikipedia verweist auf diverse Personen mit diesem Namen, von denen aber schwerlich für diesen Fall eine in Frage kommt. Bleibt nur der eventuelle Bezug auf das 1826 erschienene Märchen „Der kleine Muck“ von Dr. phil. Wilhelm Hauff, 1802-1827, einem deutschen Schriftsteller der Romantik, der N, wenn auch nicht nachweislich so doch bekannt gewesen sein dürfte, weil damals alle Welt dessen Geschichten und Märchen kannte.
Vielleicht aber ist aus der Originalhandschrift statt Muck „Murr“ zu lesen? - Das wäre die „Hauptperson“ in dem viel gelesenen Roman „Lebensansichten des Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johann Kreisler in zufälligen Makulaturblättern“ aus den Jahren 1819 bis 1821 von dem außerordentlich vielseitigen deutschen Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, 1776-1822, den N nachweislich kannte und dessen Auseinandersetzung mit der Zerrissenheiten des Künstlers gegenüber der bürgerlich gemütlichen Behaglichkeit N gewiss angesprochen haben wird. 1859 berichtete N seinem Freund Wilhelm Pinder ja sogar davon, wie er sich „nach der Anweisung des Kater Murr bemühe lateinisch zu denken.“ 6.2.59In diesem Roman findet sich auch die Verbindung von Musik, Gemütlichkeit - derzeit Ns Lieblingswort und die Verbindung zu Ns nachfolgenden französischen Einsprengseln, denn Kater Murr „zieht sich schließlich in das friedvollere Dasein eines homme de lettres [eines Schriftstellers] zurück. Der Kater beschreibt mit besonderem Nachdruck seine Entwicklung zum Schriftsteller, was E.T.A. Hoffman hinreichend Gelegenheit zur kritischen und parodistischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen literarischen Richtungen und kulturellen Bemühungen der zurückliegenden Jahrzehnte gibt.“ KLL7.973So ist es in Kindlers Literaturlexikon angeführt.
Dass N sich den Alias-Namen des Katers Murr aus E.T.A. Hoffmanns Spott auf die Bürgerwelt zulegte ergab Ns Wesen gemäß durchaus Sinn und passte genau zu dem, was er in ein - allerdings fehlerhaftes! - Französisch gesetzt, dem gesiezten, also nicht sehr nahe gekommenen Freund folgen ließ: „homme édtudié en lettres“, was wohl so viel heißen sollte, wie studierter, oder gelehrter, jedenfalls nicht nur einfacher, allerweltsmäßiger „Schriftsteller“, auf N bezogen natürlich, aber mit dem „en“ gleich „in“ insofern als falsch gelten muss, weil es das „en“ in Verbindung mit „lettres“ im Französischen nicht gibt; es sei denn, N wollte eigenmächtig und ganz bestimmt zum Ausdruck bringen, dass er „in Sachen Buchstaben“ ein besonders Studierter sei. Und dazu dann die dem sonstigen Brief entsprechende Wortspielerei „(votre ami san[s] lettres)“, was mit dem Fehler, das „s“ vergessen zu haben, übersetzt so viel heißen sollte als: Ihr briefloser Freund.
Danach reizte es N, sich vor dem „Kollegen“ d.h. Mitschüler noch ein wenig zu spreizen. Er schickte ihm das erwähnte „Kirchenlied“ und das „Stückchen Selbsterlebnis“, welche beide „innerlich“ sonderbar zusammenhanglos zu den vor kurzem doch noch so wichtig genommenen Jugendaufsätzen über „Fatum, Geschichte und Willensfreiheit“ wirken:
Du hast gerufen: Herr, ich eile Und weile An deines Thrones Stufen. Von Lieb entglommen Strahlt mir so herzlich, schmerzlich Dein Blick ins Herz ein: Herr ich komme.
Ich war verloren, Taumeltrunken, Versunken, Zur Höll’ und Qual erkoren [eine durchaus sonderbare Anwendung dieses Wortes in diesem Zusammenhang! Es zählte aber wohl, dass er „erkoren“ wäre! - Oder war es nur der Reim-dich-oder-ich-fress-dich-Widerklang auf „verloren“?] Du standst von ferne: Dein Blick unsäglich Beweglich Traf mich so oft: nun komm’ ich gerne.
Ich fühl ein Grauen Vor der Sünden Nachtgründen Und mag nicht rückwärts schauen. Kann dich nicht lassen. In Nächten schaurig, Traurig Seh’ ich auf dich und muss dich fassen.
Du bist so milde, Treu und innig, Herzensminnig, Lieb Sünderheilandsbilde! Still mein Verlangen, Mein Sinn’n und Denken zu senken In deine Lieb, an dir zu hangen. -
Das klingt als käme es aus der ungetrübten und nicht zu erschütternden Gläubigkeit seines Herkommens und es hätte die Emerson-Infektion nicht gegeben. Dass die beiden „Strömungen“ konfliktfrei nebeneinander her bestehen konnten verrät eine Unbeteiligtheit sowohl von der einen als auch der anderen Seite; - und als hätte er noch keinen Blick hinter die Kulissen seines angestammten Glaubens getan. Vielleicht steckt aber auch eine gehörige Portion Bosheit in dem gekonnten Umgang mit alten Formen und Sprüchen, - als eine N-typische „Auseinandersetzung“ mit dem, was er glauben sollte aber nicht mehr konnte ? Offensichtlich aber ohne dabei über diese Zusammenhänge nachzudenken und das Gesamte in einen logischen Zusammenhang zu bringen.
Darauf folgt u.a. das romantische „Selbsterlebnis“ im schwülen Schmoren weltschmerzlich sündiger Sehnsüchtigkeit:
Schweifen, o Schweifen! Schweifen o Schweifen Frei durch die Welt so weit Mit grünen Schleifen an Hut und Kleid. Schwing ich das Glöcklein, Klingt es so lieb, so lind. Es flattern die Löcklein Um mich im Wind. Sehn mich die Rehe So herzig an im Wald, Wird mir so wehe, Vergess’ es doch bald. Blühet ein Röslein Duftig im Haidegras, Küss’ ich das Röslein Und wein etwas. Lustig, wie Wind zieht, Streift durch das Herz ein Traum, Fällt eine Lindblüt Herab vom Baum. Schweifen o Schweifen Frei durch die Welt so weit Mit grünen Schleifen an Hut und Kleid! -
Das brannte und genoss sich in unstillbarer Sehnsucht, - vor allem nach superlativer Ungebundenheit, was zugleich aber heißt, dass es N im Maß seiner Sehnsucht vor jeder Art von Verpflichtetsein - nicht aber vor derart holprigen Versen? - zu grausen schien. Diese Dichterei folgte nicht dem Prinzip des Empfundenen, sondern des Gewollten, denn alles war gewaltsam aufeinander hingetrimmt. Und wieder gab es, außer den so herzig - aber auf ihn ! - blickenden Rehen im Wald, niemanden außer ihm selber , der seine Freude daran hatte, dass sich alles um ihn selbst herum in Bewegung hielt.
Wie ging das an? Der junge Mann stand im 18. Lebensjahr, gebildet, weit überdurchschnittlich geschult in Griechisch, Latein und hatte damit jahrelang durchaus nicht immer nur eng christlich orientierte Weisheiten in sich aufgenommen! Wie hat N den hier geleisteten „ungeistigen“ Spagat, der ein recht hohes Maß an Unreife verrät, zwischen zwei sich so sehr widersprechenden Welten fertig gebracht? Ohne alarmierende Anzeichen dafür, dass da entsprechende Spannungen hätten entstanden sein müssen? Vielleicht erklärt sich das relativ einfach: Dass nämlich das Erlebnis und die Erkenntnis aus Emerson sich einfach auf einer ganz anderen Ebene seiner Persönlichkeit abgespielt hat, das heißt „erlebt“ worden ist und ihm „an und in ihm selbst“ etwas erklärt hat, was ihm bislang zwar fragwürdig erschien, sich aber mit dem sonstigen Bereich seiner Erlebnisweisen noch nicht konfliktweise berührte, sondern, wie zu erkennen, friedlich und problemlos nebeneinander her ging, wie zukünftig die logischen Widersprüchlichkeiten zwischen Ns überaus ausgeprägter Kritik-Fähigkeit an „den Anderen“ neben seinen völlig selbstkritiklos behandelten Ideen zu für ihn so wichtigen Einfällen, wie die „Ewige Wiederkehr“ und die „Züchtung des Übermenschen“ und seinem ansonsten vielseitig ungetrübt gepflegten Zweierleimaß in vielen Dingen.
Читать дальше