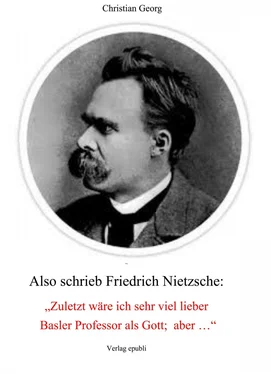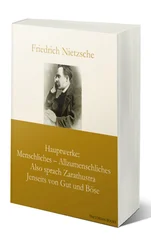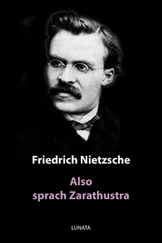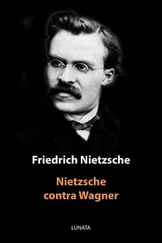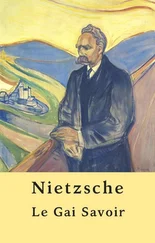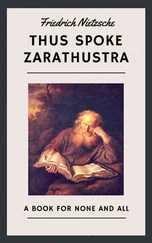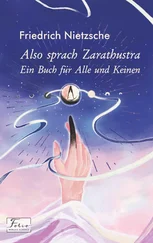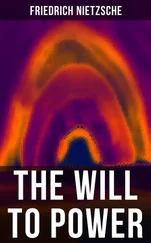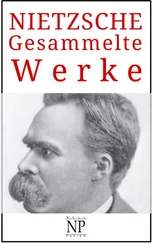Die Unterstreichung stammte wieder von N. Den Anfang dieses Textes hat N auch seitlich mehrfach angestrichen, was darauf verweist, dass ihm diese Stelle wichtig war.
So weit zu Ns „Kreisen“ aus Emersons Kapitel über „Kreise“. In seinem Aufsatz schrieb der junge N, von all diesen Gültigkeiten zutiefst angetan, weiter:
Indem der Mensch aber in den Kreisen der Weltgeschichte mit fortgerissen wird, entsteht jener Kampf des Einzelwillens mit dem Gesamtwillen [von dem bei Emerson nirgends die Rede war. Bei ihm gibt es nur den „Willen“, gelegentlich erweitert zu „willenlos“, „Willenstreue“, „Willensanwandlung“, „Willenskraft“ sowie „Un-„ und „Widerwille“. Bei Emerson bestand nirgends - wie N hier behauptet, ein Kausalzusammenhang zwischen dem „von der Weltgeschichte Fortgerissenwerden“ und einem „Kampf des Einzelwillens mit dem Gesamtwillen“. N wollte aus seiner Parteinahme heraus einen solchen erkennen, erklärte aber dazu - etwas zusammenhanglos eigentlich! - nur weil ihn das - im seinem eigenen Zusammenhang mit dem Ganzen! - persönlich am stärksten beschäftigte:]; hier liegt jenes unendlich wichtige Problem angedeutet, die Frage um Berechtigung des Individuums zum Volk, des Volkes zur Menschheit, der Menschheit zur Welt; hier auch das Grundverhältnis von Fatum und Geschichte .
Über das „Fatum“ - das war bei den Griechen und Römern ein „unwiderruflich gegebener Götterspruch“, ein „Verhängnis“ - war N für seine Jugendaufsätze aus Emersons inzwischen verfügbarer und verinnerlichter „Führung des Lebens“ hinreichend aufgeklärt worden. In dessen 1. Kapitel, „Das Fatum“ betitelt, erklärte Emerson dort nämlich:
Es war ein poetischer Versuch, diesen Berg des Verhängnisses [nämlich dass wir so sind, wie wir sind!] zu lüften, welcher die Hindus sagen ließ: „Fatum ist nichts als die Taten, welche wir in einem früheren Zustande unsres Daseins begangen haben.“ EL.8
Mithin also so etwas, wie eine „Erbsünde“? Etwas uns irgendwie und -woher Anhängendes? - oder vielmehr: Uns aus systemintern religiösen Logik-Zwängen Angehängtes , das a) aus einer Vielzahl von Gründen vom einzelnen Individuum nicht ohne weiteres zu beeinflussen ist und b) um in machttaktischen Fragen keine Entscheidungsbefugnisse in unkontrollierbare „Hände“ geraten zu lassen! Des Weiteren heißt es in Emersons sehr speziellem Kapitel:
Und zu allerletzt, hoch über den Gedanken in der moralischen Welt erscheint das Fatum als Sieger, indem es das Hohe erniedrigt und das Niedere emporhebt, Gerechtigkeit vom Menschen fordernd und früher oder später zu[zu?]schlagen bereit ist, wenn Gerechtigkeit nicht gewährt wird. Was nützlich ist, wird dauern, was verderblich ist, wird sinken. EL.14
Daraus wurde, ein Jahr später, im Juni 1863 anlässlich Ns dann gereiftem Plan, den Freunden Emersons Buch - das heißt die beiden N begeisternden Bücher, die „Essays“ und die „Führung des Lebens“, vorzustellen, der Satz: Seine Betrachtungsweise amerikanisch [aber was wusste N schon davon, inwieweit das nun typisch „amerikanisch“ war?]. „das Gute bleibt, das Böse vergeht.“ BAW2.221, was den Tatsachen dieser Welt wieder mal absolut nicht entsprach und auch nicht unbedingt traf, was Emerson hatte zum Ausdruck bringen wollen.
Die Beschränkung ist der Einsicht des Menschen undurchdringlich [wofür N selbst das schlagende Beispiel an versäumter Selbsterkenntnis geliefert hat. Er hat seine Begrenztheit „innerhalb der Gültigkeiten Emersons“ zu keiner Zeit seines Lebens erfassen und einschätzen können!]. In ihrer letzten und erhabensten Bedeutung sind Einsicht und Freiheit des Willens selbst Glieder, die ihr [wem? der „Beschränkung“? der „Einsicht“? der „Freiheit“? dem „Willen“? dem „Menschen“? der „erhabensten Bedeutung“?] dienen. EL.15
Bis auf das letzte ergibt von alledem nichts auch nur annähernd einen Sinn. Man liest darüber hinweg ohne es recht verstehen zu können. Als offensichtlich falsch ist es nicht zu erkennen, aber man fühlt sich nicht klüger, wenn man diesen Gedankenverläufen Emersons Folge leistet. Es sei denn, man denkt sich „sein Teil“ und idealisiert sich in die logisch klaffende Lücke hinein!
So zeichnen wir das Fatum in Materie, Geist und Moral in den Rassen, in der Lagerung der Erdschichten eben so wohl als in Gedanken und Charakter. Überall gibt es Grenzen und Schranken. Aber auch das Fatum hat seinen Herrn; die Begrenzung ihre Grenzen; und sie nehmen sich von oben anders als von unten, von innen anders als von außen aus. Denn wenn das Fatum unendlich ist, so ist auch die Kraft [aber was macht diese - hier unverhofft eingeführt! - aus? Und dann ist diese willkürlich irgendwo hergenommene Kraft], welche der zweite Faktor dieser dualistischen Welt ist, [auch noch, und auch bei Emerson schon, „superlativisch“] unendlich. Wenn das Fatum die Kraft verfolgt und beschränkt, so erwartet und bekämpft die Kraft das Fatum. Wir müssen das Fatum als Naturkraft respektieren, aber es gibt etwas Höheres als Naturkraft. Wer oder was ist dieser Kritizismus, der [versucht, die Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis festzustellen und] in die Materie eindringt? Der Mensch ist keine Ordnung der Natur ….. [kein] Kettenring oder eine überflüssige Bagage [Gesindel, Pack], sondern ein lebendiger Antagonismus [Gegensatz], ein Versuch, die Pole des Universums zusammen zu ziehen [und da kehrte Emerson - aus Verlegenheit? - mal wieder den Maulhelden hervor, obgleich derlei doch auf gar keine Weise möglich ist! Es klingt nur „schön“, aufregend, mächtig und ist dabei nicht mehr als billige Effekthascherei!].
Er [der Mensch] verrät sichtlich seinen Zusammenhang mit dem, was unter ihm ist, mit jenen dickschädeligen, kleingehirnten, vierhändigen Säugetieren und ist völliger Gleichheit mit ihnen nur entgangen, indem er zum Zweifüßler wurde, wobei er für seine neuen Körperkräfte teuer genug durch den Verlust einiger alten bezahlte [grad so, als ob „er“ sich in seinen Möglichkeiten verschlechtert hätte! - Von der gleichzeitigen Entwicklung zur Sprachfähigkeit als ein wesentliches Mittel zum Verständnis der Welt war weder bei Emerson, noch bei N die Rede!]. Aber der Blitz, der herniederzuckt und Planeten formt, der Schöpfer der Planeten und Sonnen, lebt in ihm. Auf der einen Seite elementarische Ordnung, Sandstein und Granit [bei N wurde daraus der „Stein“], Felsenlagen, Torfmoore, Wälder, See und Küste, auf der andern der Gedanke, der Geist, welcher die Natur zersetzt und zusammensetzt - da habt ihr sie, in einander verschmolzen, Gott und Teufel, Kraft und Stoff, König und Verschwörer, friedlich zusammen findend im Auge und Hirn eines jeden Menschen. EL.15f
Wie alles Leben, nur möglich war indem es zu einem zielgerichteten „Umgang mit Informationen“ kam, was neben der Energie und der Materie einen „Freiraum“ für das Leben ergab. Das blieb bei Emerson sinngemäß recht dunkel gehalten, ahnungsvoll, andeutungsweise, mit großen Worten garniert. Und ob Fatum und Kraft unendlich sind oder winzig klein? Was sollte den Unterschied machen, solange die beiden sich in unverbrüchlichem Gleichgewicht gegenüberstehen? Alles in allem bezeugte Emerson da ein recht verschwiemelt durcheinander gedachtes Weltbild, das N lehrmeisterlich entgegentrat und in seiner Großspurigkeit von ihm weitgehend kritiklos hingenommen wurde. In seiner Gegenüberstellung der Materie gegen den „Geist“ - der sich woraus ergab? - kämpfte auch Emerson noch recht vergeblich mit einem für die Menschen uralten Widerspruch - sofern es denn einer ist! - der damals noch keinen angemessenen Standpunkt, ihn zu beurteilen, gefunden hatte.
Der freie Wille kann nicht abgestritten werden, oder, um das Paradoxon auszusprechen: Freiheit ist notwendig. Wenn du dich selbst auf die Seite des Fatums stellst und sagst, dass Fatum Alles ist, dann müssen wir sagen, dass die menschliche Freiheit ein Teil des Fatums ist. Fortwährend bewegt die Kunst zu wählen und zu schaffen die Seele. Verständnis vernichtet das Fatum; so wie der Mensch denkt, ist er frei.
Читать дальше