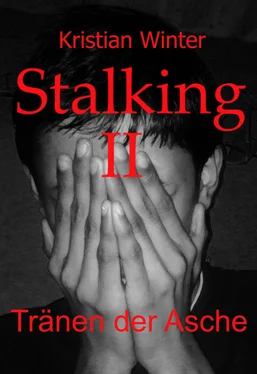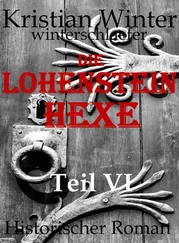Dann aber erzählte sie auch von weiteren Dingen, vor allem von Bektül, ihrer großen Liebe, in den sie offenbar noch immer sehr vernarrt war. „Was ich gesagt habe, war Unsinn“, gestand sie dabei erstaunlich offen. „Niemand kann einen Mann allein aus Angst lieben. Abneigung und Ekel werden immer zu Hass und Gleichmut führen. Man wird innerlich leer, selbst dem eigenen Kind gegenüber, denn es ist keine Frucht der Liebe, sondern des Zwanges. Mit Bektül wäre das anders gewesen. Das weiß ich! Nach meiner Hochzeit ist er fortgezogen und hat eine andere Frau geheiratet. Ich aber werde ihn immer lieben, auch wenn ich ihn niemals haben kann. Seinetwegen hatte ich schon Todesgedanken, vor allem nach der ersten Nacht mit Mustafa.
Wie habe ich mich davor gefürchtet, so dass ich es nur möglichst schnell hinter mich bringen wollte. Er aber wurde nicht fertig und begann mich zu quälen. Als er dann merkte, dass ich ‚haram‘ war, schlug er mich mehrfach ins Gesicht und spuckte mich an. Dann griff er nach einem Messer und wollte mich schächten wie ein Schaf. Ich wusste, dass meine letzte Stunde gekommen war und hielt ganz still. Nur ein kleiner Schnitt, dachte ich, und es ist vorbei. Es ist seltsam, was man in einem solchen Moment alles denkt - Bedeutsames verschwimmt und Nebensächliches tritt hervor. Ich hatte nicht einmal Angst, und hätte er es getan, es wäre mein Eintritt ins Paradies gewesen. Aber dann ließ er von mir ab, kauerte sich in eine Ecke und begann zu heulen. Es war schrecklich ... Warum ich das alles ertrug, ist nur schwer zu erklären“, kam sie meiner Frage zuvor. „Aber ich denke, dass äußerer Schmerz oftmals den inneren verdrängt. Allah hat es so eingerichtet und sich dabei etwas gedacht. Ich bin sehr gläubig, wissen Sie. Der Glaube gibt mir die Gewissheit, dass es mehr gibt, als nur mein eigenes Leben. Wir sind Bestandteile eines größeren Ganzen und daher nur bedingt für unser Schicksal verantwortlich. Das ist sehr beruhigend. Sind Sie eigentlich gläubig?“
„Kaum“, gab ich halblaut zurück.
„Warum?“
„Weil ich manchmal auch an meinem Glauben zweifele, vor allem, wenn sich alles gegen mich verschworen hat.“
„Dann glauben Sie an den Shaitan.“
„An wen?“
„An den Teufel. Jeder Mensch glaubt mehr an den Teufel als an Gott. Das liegt in der Natur des Menschen.“
„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber wie kommst du darauf?“
„Weil der Glaube unser Schicksal bestimmt.“
„Klingt logisch und ist doch Unsinn. Der Mensch ist zuerst für seine Taten verantwortlich und nicht für seine Gedanken. Wie kommst du auf solche Ideen und wieso kannst du eigentlich so gut deutsch?“, wollte ich wissen und erfuhr, dass sie einen intensiven Sprachkurs machte und sogar die höhere Reife belegte. Ursprünglich habe sie studieren wollen, aber der Imam sei gegen ihr Interesse für Rechtswissenschaften oder Philosophie gewesen, da diese nach hiesiger Auslegung nicht mit dem Koran übereinstimmten. Ihr Heimatland sei ihr inzwischen fremd geworden und sie kenne es nur aus Erzählungen. Dennoch wäre sie den Traditionen ihres Clans schon immer derart verpflichtet gewesen, dass ihr eine Emanzipation und somit Entwicklung nach westlichem Vorbild unmöglich blieb.
„Aber ist es nicht schwer, die eigenen Wünsche dauerhaft zu unterdrücken?“, fragte ich, da mir diese Argumentation nicht einleuchtete. „Ich meine, du wolltest studieren und ausbrechen. Jetzt fliehst du zu mir und suchst Schutz, beteuerst aber zugleich deine Traditionsverbundenheit und Frömmigkeit. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht.“
„Vielleicht ist es gerade das, was uns trennt. Wir leben die Religion. Sie liegt in unserem Blut. Etwas anderes ist unmöglich, selbst wenn wir manchmal zweifeln“, antwortete sie in einem eigentümlich gedämpften Ton, als spräche sie mit sich selbst.
„Nun gut, das ist dein Recht und da hat niemand was dagegen. Nur sollte die Religion nicht deine Entwicklung behindern. Sonst wäre sie wirklich der Shaitan. “
„Das tut sie nicht! Im Gegenteil, sie gibt den einzig richtigen Weg vor. Und darüber bin ich dankbar.“
Das verstand ich zwar nicht, verzichtete aber auf erneuten Widerspruch. Vielmehr interessierte mich, wie es jetzt weitergehen sollte, und fragte nach ihren Vorstellungen.
„Das weiß ich nicht“, antwortete sie. „Vielleicht muss ich erstmal etwas Abstand gewinnen und mir über einiges klar werden. Ich werde Ihnen aber nicht lange zur Last fallen. Das verspreche ich.“
„Unsinn! So war das nicht gemeint! Du kannst natürlich bleiben, solange es nötig ist. Anderenfalls begäbst du dich in Lebensgefahr. Ich werde schon etwas für dich finden.“
„Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll!“
„Nicht nötig. Vielleicht habe ich damit nur etwas gutzumachen.“
Das verstand sie sehr genau, besaß jedoch den Takt, nicht weiter daran zu rühren. Dafür war ich dankbar.
Die nächsten Tage vergingen qualvoll. In ständiger Erwartung irgendeiner unliebsamen Überraschung, wagte ich mir die Konsequenzen meiner Eigenmächtigkeit nicht auszumalen. Immerhin dauerte dieser Zustand jetzt schon fast eine Woche, ohne dass ich zu einer Entscheidung kam. Da aber nichts geschah und man meinen Gast offenbar auch nirgendwo vermisste, lullte mich das allmählich ein. Es folgte eine Alltagsroutine, die mir bald so vertraut wurde, als wäre dieser Trott niemals anders gewesen, und es wäre gelogen, würde ich behaupten, dass sie mir nicht gefiel.
Wenn ich morgens aus dem Haus ging, schlief Halime meistens noch. Kehrte ich nachmittags zurück, empfing sie mich mit ihrem unnachahmlichen, stillen Lächeln. Manchmal umarmte sie mich sogar und ich wiederum fand Gelegenheit, mich auszusprechen. Nicht selten lachten wir dabei und alle Probleme waren wie weggeblasen. Damit hatte meine Einsamkeit ein überraschendes Ende gefunden. Schon deshalb wies ich jeden Gedanken an eine Trennung von mir. Vielmehr ertappte ich mich bei der Vorstellung, sie dauerhaft bei mir zu behalten, notfalls sogar als ihre Betreuerin. Es gab da gewisse Möglichkeiten und ich hatte mich bereits erkundigt.
Umso mehr überraschte mich eines morgens die gedrückte Atmosphäre in unserem Büro. Es herrschte eine geradezu beunruhigende Schweigsamkeit. Die Baderhof beachtete mich kaum und selbst die sonst so schnatterhafte Ermel wirkte erstaunlich unterkühlt. Und als ich dann ein beiläufig unter meine Tastatur geklemmtes Schriftstück entdeckte – ein amtliches Schreiben aus irgendeiner Kanzlei –, dämmerte mir etwas. Dabei handelte es um die Vermisstenmeldung einer jungen Frau, welche ein Anwalt als Vertreter der islamischen Gemeinde im Namen einer Familie El Jeries aufgegeben hatte und um Beachtung bei unserer Arbeit bat.
Damit nicht genug. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem Anwalt um niemand anderen als einen gewissen Herrn Ahmet S. und er war sogar persönlich erschienen, angeblich um sich über die Frage der Zuständigkeiten zu informieren. Das war natürlich Unsinn, denn so etwas war bekannt. Wenn dieser Kerl hier aufschlug, dann aus anderen Gründen. Natürlich konnten das diese Weiber nicht wissen. Woher auch. Sie glaubten ohnehin alles, was ihnen ein Anwalt erzählte.
Mir wurde mir sofort klar, welche Masche er dabei abgezogen hatte und wie überrascht er tat, in einem geschickt provozierten Gespräch meinen Namen zu hören. Das war sozusagen seine Spezialität, aus einer gespielten Naivität heraus die Arglosigkeit seines Gegenübers zu wecken, um dann über scheinbare Nebensächlichkeiten sich dieser Vermutung zu vergewissern.
Ich konnte förmlich sein erstauntes Gesicht sehen, als er fragte: „Frau Möller? Doch nicht etwa die Frau Möller, welche … Nein, ich fasse es nicht … Ja, wir kennen uns. Wir sind alte Bekannte. Hat sie noch nicht von mir erzählt? Wie schade. Grüßen Sie sie von Herrn Selimgüler. Sie weiß dann schon Bescheid.“
Читать дальше