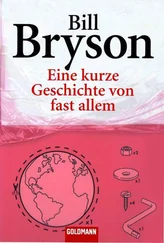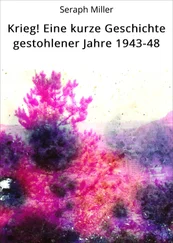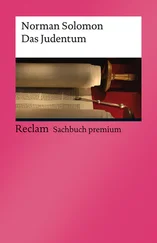Literaturinterne Kriterien werden neben den genannten literaturexternen Periodisierungskatalogen zur Epochengliederung genutzt […]
Epochenbegriffe können auch aus den Einschätzungen viel späterer Zeiten resultieren, Literaturgeschichtsschreibung dokumentiert immer auch die Rezeptions- und Kanonisierungsgeschichte der Literatur: So ist etwa der Begriff der ‚Weimarer Klassik’ eine Erfindung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der nicht so sehr aus den Texten Goethes und Schillers zwischen 1788 und 1805 selbst abgeleitet wird, sondern aus der Stilisierung und Verklärung dieser beiden Autoren resultiert. (Jeßing 2007, S. 11f.)
Damit sind Epochenbegriffe wissenschaftliche Konstruktionen und dies gilt auch für eine Geschichtsschreibung der Kinder- und Jugendliteratur. Die Kinder- und Jugendliteraturgeschichte korrespondiert nicht mit der Literaturgeschichte der Erwachsenenliteratur, manchen Epocheneinteilungen, wie etwa die Literatur des Vormärz, finden sich in der Kinder- und Jugendliteraturgeschichte nicht. Bis 1945 folgt die Einteilung der hier vorliegenden Geschichte den bereits erwähnten Kriterien. Nach 1968 differenziert sich die Kinder- und Jugendliteratur immer weiter aus. Die Literaturgeschichte im Bereich der Erwachsenliteratur wählt Zuschreibungen wie „Die Literatur der Bundesrepublik“ (Metzler) oder „Literatur im Westen“ und „Postmoderne“ (Jeßing). Nach 1945 ist eine Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur vielfältig und lässt sich lediglich in Trends und Tendenzen skizzieren, die sowohl eine thematische Öffnung als auch eine Ausdifferenzierung der Gattungskonventionen beinhalten. Anhand des Kinder- und Jugendromans werden unterschiedliche Muster erläutert und so auch Trends und Tendenzen aufgenommen.
In Einschüben werden jene Autoren/innen und Werke vorgestellt, die einerseits eine hohe Bedeutung innerhalb der Kinder- und Jugendliteraturgeschichte besitzen, andererseits auch jene, die bis heute lieferbar sind und im Kontext der Arbeit als Lese und Literaturpädagogin/Pädagoge eingesetzt werden können.
Und noch etwas macht die Skizze der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur deutlich: Eine deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur kann nicht losgelöst betrachtet werden von den Entwicklungen auf dem internationalen Kinder- und Jugendliteraturmarkt. Eine solche Verzahnung ist kein Charakteristikum des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, sondern machte sich bereits im 19. Jahrhundert bemerkbar.
2. Anfänge der Kinder- und Jugendliteratur (1450-1750)
Es war lange Zeit in der Forschung umstritten, wann man von Anfängen einer deutschen Kinder- und Jugendliteratur sprechen kann: In der Literatur der 1970er und 1980er Jahre wird die Kinder- und Jugendliteratur als ein Ergebnis der Aufklärung wahrgenommen (vgl. Glasenapp/Weinkauff 2010, S. 18), da erst mit der Epoche der Aufklärung es zu einer Entdeckung der Kindheit kommt. Aber eine solche Perspektive wird durch neuere Ergebnisse aus der historischen Kinder- und Jugendliteraturforschung überholt und mittlerweile herrscht Konsens darüber, dass die Anfänge der Kinder- und Jugendliteratur ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Die hier in lateinischer Sprache entstandenen Werke, die sich an adelige Kinder sowie der Ausbildung des Klerus richten, sind Lehrbücher mit denen drei erzieherische Funktionen verknüpft werden sollten: (1) Alphabetisierung, (2) Einweisung in religiöse Dogmen, (3) Vermittlung von Grundwissen und Verhaltensregeln (vgl. Kümmerling-Meibauer 2012, S. 34).
Neben den lateinischen Lehrwerken existieren im Spätmittelalter ebenfalls deutschsprachige Unterrichtswerke. Aber auch Artus- oder die ritterlich-höfische Standesliteratur können als die Anfänge einer Kinder- und Jugendliteratur bezeichnet werden, denn spätestens mit dem Entstehen des Buchdruckes kommt es hier zu einer Ausweitung des Gattungsspektrums, ohne jedoch explizit auf kindgemäße Interessen einzugehen. Kindheit wird in jener Zeit nicht als eigenständige Phase, sondern als „Vorbereitungsphase auf das Erwachsenendasein“ (Schikorsky 2012, S. 11) verstanden. Literatur dient zudem der Belehrung, soll erziehen und ist an Leser und Leserinnen der höheren Schichten adressiert. Während des Humanismus entwickeln sich neue Genres – etwa das Schuldrama oder das Lehrgespräch.
Als Anfänge der Sachliteratur und der Bilderbücher wird in der Forschung das zweisprachige Realienbuch
Orbis sensualium pictus
(1658) von Johann Amos Comenius betrachtet.
| Johann Amos Comenius(d.i. Jan Amos Komensky; 1592-1670) gilt als der wichtigste Vertreter eines erneuerten philosophischen Christentums im 17. Jh.. Sein Hauptanliegen war es, die Trennung der verschiedenen Wissensbereiche zu überwinden und alles Wissen (von Gott, der Welt, den Wissenschaften) in ein universales System der Lehrbücher, Schulen, Wissenschaften und Gelehrten zu überführen. Pansophischen Vorstellungen folgend, begriff Comenius die Schöpfung als einen Prozess, der aus gestaltloser Einheit in Gott zur von Gott geschaffenen Mannigfaltigkeit der Welt und wieder zurück zu einer (höheren) göttlichen Einheit führte. Diese sah er in einem – seiner Überzeugung nach – unmittelbar bevorstehenden Friedensreich verwirklicht. Vor diesem Hintergrund ist Comenius’ Forderung nach einer allumfassenden, enzyklopädischen Bildung zu begreifen. (Schikorsky 2012, S. 21) |
Charakteristisch für das
Orbis pictus
sind thematisch zusammengestellte Kapitel, die in die Naturphänomene, Berufen, Wissenschaften und bürgerliche sowie politische Ordnungen einführen (vgl. Kümmerling-Meibauer 2012, S. 35).
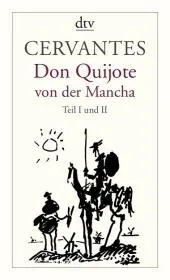 Ritte
Ritte
rromane
bilden sich im späten Mittelalter heraus und gehören zu den beliebtesten literarischen Gattungen. Sie begeisterten insbesondere junge Leser und Leserinnen. Der bis heute sicherlich
bekannteste Ritterroman dürfte
Don Quijote
(1605) des spanischen Miguel
de Cervantes (ca. 154
7-1616) sein.
3. Aufklärung (1750-1800)
Mitte des 18. Jahrhunderts verändert sich das literarische Leben in Deutschland: Die Buchproduktion steigt an, der Bereich der Literatur, und damit auch der der Kinderliteratur, weitet sich aus. Es kommt zu einer Kommerzialisierung des Verlagswesens sowie des Buchhandels. Kümmerling-Meibauer stellt fest, dass allein im gesamten 18. Jahrhundert ca. 3.000 Kinderbücher, inklusive Schulbücher, erschienen sind. Bis ins 18. Jahrhundert dominierte das ‚intensive Lesen’, also ein wiederholtes Lesen desselben Buches, was im 18. Jahrhundert vom ‚extensiven’, also einmaligem Lesen eines Buches, abgelöst wird. Dies wiederum führt zu Debatten um Lesesucht und Vielleserei, die auch im 19. Jahrhundert fortgesetzt werden und insbesondere die Lektüre von Frauen betreffen. Das, was heranwachsende und erwachsene Frauen lesen sollen, wird von Erziehern kontrovers und u.a. auch in der Ratgeberliteratur diskutiert. Dabei gerät insbesondere der Roman in den Blick der Kritik, aber auch das eskapistische Lesen. Die Leser und Leserinnen stammen überwiegend aus der Schicht des Bürgertums, die die Literatur als das zentrale Medium ihrer Kommunikation nutzen (vgl. Wild, S. 44). Zugleich kommen mit Frauen und Kindern auch neue Leserschichten hinzu.
Das 18. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Pädagogik, da sich die Erziehung als Wissenschaft herausgebildet hat. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) beschreibt in seiner Schrift Émile oder Über die Erziehung (1762) die Unterschiede zwischen Kindheit und Erwachsensein. Daraus folgt, dass Kinder nicht nur auf das Leben als Erwachsene vorbereitet sein sollen, sondern dass Kindheit – und hier ist Kindheit fast ausschließlich auf bürgerliche Familien beschränkt – als eigenständige Phase anerkannt wird. Die bürgerliche Familie bietet demnach Kindern eine Art Schonraum, um sich zu entfalten und zu spielen. Ein solches „spielerisches Probehandeln“ der Kinder ist ohne „gesellschaftliche Konsequenzen“ (Schikorsky 2012, S. 26). Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen kommt es zudem zu einer Trennung von Familie und Beruf: Der Mann arbeitet außerhalb der Familie, Kindern werden somit Erfahrungen mit einer Arbeitswelt genommen; Frauen dagegen sind für den Haushalt und die Familie verantwortlich. Ein solcher Wandel beeinflusst die Entwicklung einer Kinderliteratur, denn das bürgerliche Kind erlebt innerhalb der Familie den privaten Raum, die Jungen, die eine Schule besuchen, lernen zudem noch im schulischen Bereich, das Leben der Mädchen ist dagegen weitestgehend auf den privaten Raum eingeschränkt.
Читать дальше

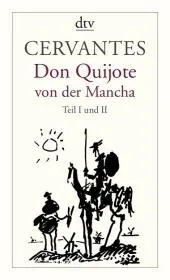 Ritte
Ritte