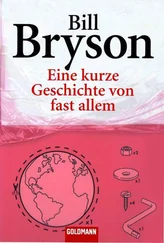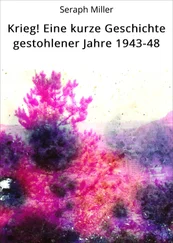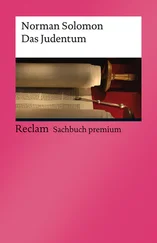Neben den bereits genannten „großen“ Kinder- und Jugendliteraturgeschichten existieren auch in Einführungen in die Kinder- und Jugendliteratur Kapitel mit Überblicksdarstellungen einer Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur – etwa in dem Band
Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur
von Bettina Kümmerling-Meibauer, aber auch in
Kinder- und Jugendliteratur
von Gabriele von Glasenapp und Gina Weinkauff. Während jedoch Bettina Kümmerling-Meibauer eine umfassende Darstellung skizziert, konzentrieren sich Glasenapp und Weinkauff nur auf bestimmte literarische Epochen. Isa Schikorsky schreibt schließlich in ihrer
Kurze[n] Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur
einen „Schnellkurs“ in die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur.
1.1. Begriffsbestimmung Kinder- und Jugendliteratur
Die Kinder- und Jugendliteratur zeichnet sich durch eine Vielfalt aus: Neben fiktionalen Texten wie Romanen, Erzählungen, Lyrik und Schauspiel existieren auch nichtfiktionale Sachbücher, hinzu kommen Bilderbücher, Comics sowie weitere Medien wie Film, Hörbuch und elektronische Spiele. Eine solche Vielfalt kann nicht vollständig berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt des hier vorliegenden Bandes steht die erzählende Kinder- und Jugendliteratur, wobei Übersetzungen ebenfalls berücksichtigt werden und zugleich auch den Einfluss auf die originär deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur aufgreifen. Existiert zu den erwähnten Werken auch ein Medienverbund, wird dieser ebenfalls kurz skizziert. Der Fokus bei der Auswahl der kinder- und jugendliterarischen Texte richtet sich dabei auf Innovativitäten innerhalb der Kinder- und Jugendliteraturgeschichte:
Dieses Kriterium, das oft auch mit dem Aspekt der Originalität in Verbindung gebracht wird, umfaßt alle literarischen Merkmale eines Textes (Inhalt, Motive, Genre, Erzählweise, Sprache usw.). Es besagt, daß der betreffende Text ein oder mehrere dieser Merkmale in die Kinderliteratur eingeführt und in vorbildlicher Weise literarisch verarbeitet hat. (Kümmerling-Meibauer 2004, S. XII).
Oder anders gesagt: Die kinder- und jugendliterarischen Texte, die im Mittelpunkt der hier vorliegenden kurzen Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur stehen, zeichnen sich durch solche innovativen Merkmale aus und haben so die weitere Kinder- und Jugendliteratur beeinflusst. Hinzu kommt auch die Frage nach dem Kindheitsbild, denn die Kinder- und Jugendliteratur greift unabhängig von literarischen Innovationen auch Veränderungen der Kindheits- und Familienbilder auf und ist somit auch an pädagogischen Diskursen beteiligt. Neben dem Kriterium der Innovativität wurde aber auch die Frage nach Leseförderung und literarischer Bildung berücksichtigt, dient doch die hier vorliegende Einführung in die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur dem Einsatz im Rahmen des Zertifikats „Lese- und Literaturpädagogik“ und kann das Studium der (Kinder- und Jugendliteratur-)Wissenschaft keinesfalls ersetzen.
Doch was ist Kinder- und Jugendliteratur? Und was versteht der vorliegende Band darunter? Der Begriff Kinder- und Jugendliteratur ist nicht eindeutig, da er einerseits Literatur für Kinder und Jugendliche, andererseits Literatur von Kindern und Jugendlichen bedeuten kann. Die Forschung meint, wenn von Kinder- und Jugendliteratur gesprochen wird, fast ausschließlich jene Literatur, die an Kinder und Jugendliche adressiert ist, aber auch solche Texte werden erwähnt, die von Kindern oder Jugendlichen verfasst wurden – verwiesen sei hier u.a. auf das
Tagebuch
(1947) der Anne Frank. Mit der medialen Wende, also der Etablierung des Internets, nimmt die literarische Produktion von Kindern und Jugendlichen zu: Fanfiction, Blogs und andere Texte entstehen und erfreuen sich großer Beliebtheit. Zugleich ist Kinder- und Jugendliteratur auch keine Textsorte, die sich an bestimmten Merkmalen wie Einfachheit, Linerarität, Regelhaftigkeit, Handlungsdominanz oder Figurentypisierung bestimmen lässt (vgl. Gansel
4
2010, S. 12). Kinder- und Jugendliteratur umfasst alle Gattungen und fast alle Genres, die auch die Allgemeinliteratur kennt: Von Pappbilderbuch für Kinder unter 3 Jahren bis hin zu Jugendromanen, die sich an Jugendliche bis zu ihrem 20. Lebensjahr richten. Auch die Erzählstruktur der Texte wandelt sich in der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur und es kommt im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert zu einer Annäherung zwischen der Kinder- und Jugendliteratur sowie der Allgemeinliteratur, was noch im Laufe der hier vorliegenden Geschichte gezeigt wird.
Um die Vielfalt der Kinder- und Jugendliteratur zu klassifizieren, wurden zumindest in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteraturforschung vier Definitionen entwickelt. Kinder- und Jugendliteratur kann sein:
1 Die Gesamtheit der für Kinder und Jugendliche als geeignet empfundenen Literatur (intentionale KJL).
2 Die Gesamtheit der für Kinder und Jugendliche geschriebenen fiktionalen und nichtfiktionalen Texte (spezifische KJL).([1] In der neueren Forschung wird der Begriff „spezifisch“ durch „originär“ ersetzt.)
3 Die Gesamtheit der von Kindern und Jugendlichen rezipierten fiktionalen und nichtfiktionalen Texten (Kinder- und Jugendlektüre).
4 Ein Teilsystem des gesellschaftlichen Handlungs- und Sozialsystems „Literatur“ („Subsystem KJL“). (Gansel 42010, S. 13)
Bettina Kümmerling-Meibauer ergänzt in Anlehnung an die Arbeiten von Hans-Heino Ewers diese vier Definitionen dahingehend, dass sie zwischen sanktionierter und nichtsanktionierter Kinder- und Jugendliteratur, also jenen Texten, „die von den gesellschaftlich autorisierten Instanzen zur geeigneten Kinder- und Jugendlektüre erklärt worden sind“ (Kümmerling-Meibauer 2012, S. 10, vgl. auch Ewers 2000). Die Definitionen vermischen verschiedene Ansätze: literaturhistorische, rezeptionsgeschichtliche, soziologische sowie pädagogische, was mitunter zu einer unsystematischen Zugangsweise führt (vgl. auch Kümmerling-Meibauer 2012, S. 10) – zumal die Forschungsrichtungen nicht einheitlich sind und statt „spezifisch“ „originär“ nutzen oder die Unterscheidung zwischen „intentional“ und „spezifisch“/“originär“ nicht deutlich gemacht wird. Der hier vorliegende Band greift die Definitionen nach Carsten Gansel auf, verweist, falls bezüglich der Begriffsbestimmung notwendig, auf die Arbeiten von Hans-Heino Ewers oder Bettina Kümmerling-Meibauer.
In diesem Band wird zudem eine strengere Trennung zwischen Kinderliteratur und Jugendliteratur versucht, denn diese beiden Literaturen unterscheiden sich seit den 1970er Jahre voneinander. Kinderliteratur – verkürzt zusammengefasst – wird als eine Literatur verstanden, die sich an Leser und Leserinnen bis zu 12 Jahren richtet, Jugendliteratur ist dagegen an jene Leser und Leserinnen bis zu ihrem 18. Lebensjahr adressiert. Es liegt auf der Hand, dass die Übergänge fließend sind.
Mit Hilfe von Epochen versuchen Literaturwissenschaftler/innen ihren Gegenstand, nämlich die Literatur, zu kategorisieren und zu ordnen. Die Kriterien einer Literaturgeschichtsschreibung sind unterschiedlich und können sich wie folgt zusammensetzen:
Politik- oder sozialgeschichtliche Unterscheidungskriterien können auf die Literaturgeschichte übertragen werden: […] nach 1945 spricht man von der ‚Literatur der BRD’ bzw. der DDR
Philosophie-, ideen- oder auch religionsgeschichtliche Epochenbezeichnungen werden auf literarhistorische abgebildet: Literatur des Humanismus, der Reformation oder der Aufklärung
Читать дальше