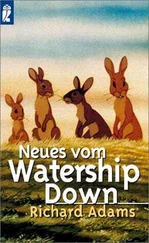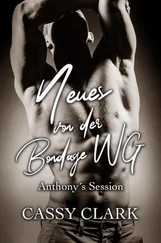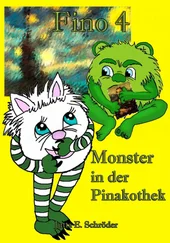Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als Judith und Heinz aufstanden. „Wir müssen los“, sagte Judith, „sonst geht der Flieger ohne uns.“ Jetzt war es endlich soweit, die Warterei hatte ein Ende.
Unsere Reise über den Atlantik sollte etwa 20 Stunden dauern. Zwischenstopps hatten wir in Madrid, San Juan und Quito. Dabei konnten wir die Uhren um sechs Stunden zurückstellen. Nach einer endlos langen Nacht in den engen Sitzen war der Blick auf das Morgenrot am Himmel wie eine Erlösung. Wie war das noch mit den „Flügeln der Morgenröte“? Könnte es sein, dass der Schreiber dieses Psalms auch in einem Düsenjet hoch über den Wolken gesessen hatte?
Gegen zehn Uhr morgens standen wir schließlich in der großen Abfertigungshalle des Flughafens in Lima und schauten uns um; wo war Herr Paulmann? Wir waren doch absolut pünktlich, warum stand er nicht mit ausgebreiteten Armen da, um uns in Empfang zu nehmen? Doch bevor ich nervös werden konnte, sah ich ihn zielstrebig aus der Menge heraus auf uns zukommen. Ich hatte ihm als Erkennungszeichen meine orangefarbene, karierte Jacke genannt, ein wahrhaft einzigartiges Merkmal, hatte dabei natürlich vergessen, dass wir vom tiefsten Winter in den tropischen Sommer geflogen sind. Somit hing die Jacke nur noch dekorativ über meinem Arm.
Herr Paulmann erwies sich als routinierter Missionsprofi. Allein wir er uns im Wagen durch die chaotischen Straßen der Stadt chauffierte, war bemerkenswert. Die schwüle Hitze wurde immer unerträglicher. Gelegentlich war die Straße mit tiefen Schlaglöchern garniert.
„Ist das nicht gefährlich?“, fragte ich. „Ich meine, die tiefen Löcher im Asphalt … bei dem Tempo und bei diesem Verkehr.“
„Wieso?“, meinte Herr Paulmann lapidar, „wir kennen die Löcher doch. Da fahren alle drum herum.“
An jeder Kreuzung standen meist jugendliche Verkäufer mit irgendwelchen Waren.
„Wenn ich einmal durch die Stadt fahre“, sagte Herr Paulmann, „kann ich mich mit allem versorgen, was ich zum Leben brauche, von Cola bis zum Motoröl.“
Wir standen wieder an einer Ampel. Ein Junge von etwa zwölf Jahren sprang an unseren Wagen und wischte schnell mit einem nassen Lappen über die Frontscheibe. Dann sah er Herrn Paulmann fragend an. Der zog etwas aus seiner Brusttasche und drückte es ihm wortlos in die Hand. Die Ampel schaltete auf grün, und wir fuhren weiter.
„Ich habe mir angewöhnt“, sagte er, „zu jedem Geldschein ein Traktat mitzugeben – auch eine Möglichkeit, Gottes Wort zu verbreiten. Aber ich sehe, du trägst deine Uhr am rechten Handgelenk. Als Beifahrer solltest du sie links tragen, sonst hast du hier nicht lange Freude daran. Die Versuchung könnte für so einen kleinen Fensterputzer zu groß sein.“
Ein Wagen kam aus einer Seitenstraße und nahm uns die Vorfahrt, irgend so ein Uralt-Straßenkreuzer, der noch von Bonnie und Clyde durchlöchert worden war. Herr Paulmann rief etwas Spanisches durch das offene Fenster.
„Der Verkehr ist das Anstrengendste hier“, fuhr er fort, „die allererste Qualifikation als Missionar in Lima ist ein nervenstarker Fahrstil. Wenn man das schafft, schafft man den Rest auch.“
An etlichen Stellen in der Stadt fielen mir bewaffnete Militärposten auf. Herr Paulmann bemerkte meinen Blick. „Das geht leider nicht anders. Von der Bank bis zum Supermarkt muss alles bewacht werden. Nachts haben wir übrigens Ausgangsperre. Ich nehme an, ihr habt vom Leuchtenden Pfad gehört, oder?“
Wir nickten still. Herr Paulmann schob das Bündel Geldscheine zurück, das er gerade halb aus der Brusttasche herausgezogen hatte. „Macht euch keine falschen Vorstellungen. Mit dem Geld hier könnte man noch nicht mal essen gehen.“
„Sieht aber nach viel aus“, wandte Judith ein.
„Kann schon sein. Aber das hier ist unsere alte Währung“, er gab uns einen zerfledderten Schein, der sich schon beim Ansehen auflösen wollte. „Das sind 1000 Soles, umgerechnet etwa 10 Pfennig. Man ist manchmal geneigt, so ein Bündel Geldscheine nicht mehr zu zählen, sondern nur noch zu wiegen. Unsere neue Währung ist der Inti; mal sehen, wie lange der hält. Aber unsere eigentliche Währung ist der Dollar. Ihr habt ja sicher auch Dollars mitgebracht und keine Intis, oder?“
Wieder nickten wir still, während Herr Paulmann schimpfend einem mit Bananen beladenen Lastenfahrrad auswich. Endlich bogen wir in eine Auffahrt ein.
„Da wären wir“, sagte er, als er vor seinem Haus den Wagen abstellte. Die Straße machte einen gepflegten Eindruck, ein wenig erinnerte mich alles an unseren letzten Spanienurlaub. Doch schon wieder wurde unser Weltbild zurechtgerückt.
„Seht ihr die hohen Mauern um jedes Grundstück? Oben drauf sind sie alle mit Glasscherben garniert. Außerdem werdet ihr kein ebenerdiges Fenster finden, das nicht vergittert ist. Vor ein paar Wochen ist unser Ältester auf offener Straße überfallen worden. Wir sind froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.“
Am Ende des Tages saßen Judith und ich am offenen Fenster unseres Gästezimmers und sahen auf die nächtliche Straße. Es war kurz nach zwölf. Gerade hatte die Ausgangssperre begonnen. Der vorhin noch pausenlos lärmende Straßenverkehr war verstummt. Nur ein einsamer Militärwagen patrouillierte vorbei. Vielleicht konnte jetzt endlich die ersehnte Nachtruhe beginnen. Morgen sollte unser Flug nach Cajamarca ins Hochland gehen. Nachdem ich mich lange genug im Bett hin und her gewälzt hatte, fiel ich in einen unruhigen Schlaf ...
Ich war zu Hause. Judith und ich wollten gerade zum Gottesdienst fahren. Doch als wir aus der Haustür traten, stand auf der Straße ein amerikanischer Straßenkreuzer mit laufendem Motor, die gesamte Seitenfront von Einschüssen durchsiebt. Ein verwegener Pistolero mit umgehängtem Patronengürtel auf der Schulter saß am Steuer, ein anderer hielt die Tür zum Fond auf und rief: „Pronto, pronto!“ Wir sprangen schnell in den Wagen, und mit quietschenden Reifen rasten wir los. Die Fahrt durch die Stadt war ein wahrer Albtraum. Keine rote Ampel konnte uns aufhalten. Ich wollte nach Judiths Hand greifen, doch ich musste feststellen, dass sie gar nicht neben mir saß. Ich war eingerahmt von zwei finster dreinblickenden Kämpfern. Direkt vor der Tür unseres Gemeindehauses blieben wir mit den obligatorisch quietschenden Reifen stehen. Die beiden zerrten mich aus dem Wagen, und wir rannten im Sturmschritt in den Versammlungsraum. Die Stühle waren besetzt von peruanischen Militärs, alle bis an die Zähne bewaffnet. Ich zwängte mich in eine Reihe und nahm Platz. Der Gottesdienst hatte begonnen. Die Orgel stimmte gerade ein Lied an, und in tiefem Bass dröhnten hundertfach die rauen Männerstimmen über mich hinweg: „Dunkel ist die Nacht der Sünde, schaurig klingt der Wogen Lied ...“ Ich rutschte immer tiefer in meinen Stuhl.
Durch eine erschütternde Detonation wurde ich aus meinem Traum gerissen ... Oder saß ich noch in unserer Gemeinde? Nein, ich lag hier in einem fremden Bett und konnte schemenhaft das nächtliche Fenster erkennen.
„Was war das?“, hörte ich Judiths Stimme.
„Ich weiß nicht, ich mache mal Licht.“
Ich griff nach der Nachttischlampe. Doch als ich den Schalter hin und her knipste, tat sich nichts.
„Meine Lampe tut’s nicht, versuch’s mal bei dir.“
Ich erhob mich und tastete mich zum Fenster. Auch draußen sah alles ungewöhnlich dunkel aus.
„Vielleicht ein Stromausfall“, meinte Judith.
Die Tür öffnete sich, und der Schein einer Taschenlampe kam ins Zimmer. „Seid ihr auch wach geworden?“, fragte Herr Paulmann.
„Ja, was ist passiert?“
„Das Umspannwerk, wahrscheinlich hat es mal wieder einen Bombenanschlag auf das Umspannwerk gegeben. Voriges Jahr hatten wir das schon einmal, dabei sind sogar zwei Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Wir wohnen einfach zu dicht dran. Macht euch keine Sorgen, morgen haben wir wieder Strom.“
Читать дальше