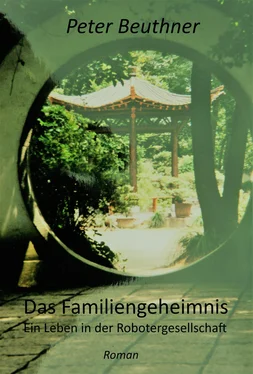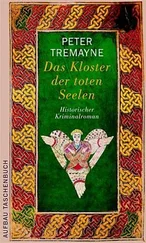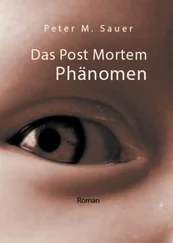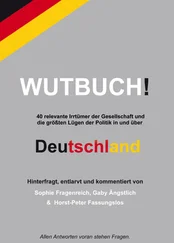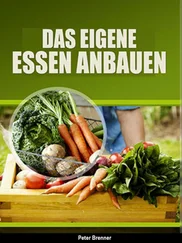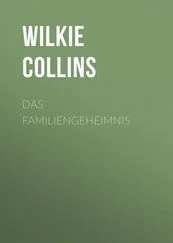„Robby hat uns schon verraten, daß es heute unser Lieblingsessen – Nang King Niu Wei – gibt“, sagte Long. Das war ein pikant zubereiteter Ochsenschwanz in Sojasoße.
„Ja, und außerdem haben wir einen Bärenhunger, deshalb konnten wir es kaum noch erwarten, bis ihr endlich gekommen seid“, ergänzte Jie.
„Jetzt seid ihr ja erlöst von der Warterei“, beruhigte Chan die Kinder, „die Raubtierfütterung kann sofort beginnen. Also bedient euch.“
Sie setzten sich zu Tisch, und Robby, der Haus-Roboter der Familie, erläuterte die Speisenfolge: „Heute gibt es folgende Menü-Auswahl: Schweinefleisch süß-sauer, Fisch mit Zitronensoße . . . und . . .“ – Robby machte eine kurze Pause, schaute in die Runde, um dann mit einem Augenzwinkern in Richtung Jiao fortzusetzen – „auf Wunsch einer einzelnen Dame“, und damit meinte er Jiao, „gibt es . . . Ochsenschwanz Nanking; außerdem gibt es grüne Bohnen mit Bambusspitzen und Won-Tan-Suppe. Ich wünsche guten Appetit!“
Alle waren begeistert und bedienten sich der köstlich duftenden und schmeckenden Speisen von den vorbeikreisenden Schüsseln. Robby schien sich über die zufriedenen Gesichter zu freuen und machte lächelnd eine kurze Verbeugung.
Genaugenommen waren es eigentlich fünf Roboter, die allen Familienmitgliedern als dienstbare „Geister“ zur Verfügung standen. Sie hörten alle auf denselben Namen. Das war einfach praktischer für die Familie, schon um mögliche Verwechslungen von vornherein auszuschließen, denn die Roboter sahen alle gleich aus.
Sie waren in der Firma von Qiang entwickelt und gebaut worden. Ihre Motorik, ihre Sensorik, ihre „Intelligenz“ und ihre Funktionssteuerung waren im Laufe der Jahre ständig verbessert worden. Inzwischen waren sie fast als perfekt zu bezeichnen. Äußerlich waren sie den Menschen nachgebildet, und sie bewegten sich auch genau wie diese. Intellektuell waren sie dem Menschen hinsichtlich eigener Kreativität noch unterlegen, aber bezüglich Geschwindigkeit und Präzision, „Gedächtnisleistung“ und „Konzentration“ schon deutlich überlegen. Sie verfügten über die Fähigkeit, die menschliche Sprache zu verstehen – auch Sätze mit „äh“, Satzbrüche und Versprecher – und sich auch selbst so zu artikulieren. Neben Deutsch verstanden sie Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch, und sie konnten aus allen diesen Sprachen ins Deutsche übersetzen. Das war ihr Standard-Sprachschatz, selbstverständlich konnte jede weitere Sprache im Bedarfsfall sofort „nachgeladen“ werden. Eigene Gefühle konnten sie noch nicht entwickeln, aber immerhin waren sie mit ihrer Wahrnehmungsfähigkeit bereits in der Lage, zwischen verschiedenen Gemütslagen des Menschen zu differenzieren und entsprechend „einfühlsam“ zu reagieren.
Da die Wangs fünf Roboter im Haus hatten, stand im Bedarfsfall jedem der fünf Familienmitglieder je einer zur selben Zeit für Dienstleistungen zur Verfügung. Sie machten praktisch alles, was so an Hausarbeit anfiel – und sie kochten vorzüglich! Sie hatten tausend Rezepte im „Kopf“, die im Laufe der Jahre durch die Familie ständig verfeinert und entsprechend einprogrammiert worden waren. Angebranntes oder noch ungares Essen, zu stark oder zu wenig gewürzt – das alles gab es bei ihnen nicht, es war immer von gleich guter Qualität.
„Und? Was habt ihr heute so erlebt?“, fragte Qiang, während er nacheinander seine drei Kinder prüfend anschaute.
„Och“, fing Long an, „ich habe ziemlich viel gelernt heute, weil wir morgen eine Prüfung in Bio haben.“
Er sprach ein sehr gutes, fast schon akzentfreies Deutsch, obwohl er erst seit etwa fünf Jahren in Deutschland lebte. Bis zu seinem neunten Lebensjahr war er in China aufgewachsen, und nur im letzten, dem neunten Jahr, als schon klar war, daß die Familie nach Deutschland übersiedeln würde, hatte er, zusammen mit den Geschwistern, zur Vorbereitung auf den Wechsel schon Deutschunterricht bekommen. Die Eltern hatten bereits vorher berufliche Kontakte nach Deutschland und im Rahmen dieser Tätigkeiten begonnen, die deutsche Sprache zu lernen.
„Was für Themen bearbeitet ihr denn gerade in Bio?“, wollte Qiang wissen.
„Wir behandeln zur Zeit die Vererbungslehre von Mendel“, antwortet Long, „ein wirklich interessantes Thema. Ich werde es auch als Vortragsthema wählen.“
Jeder Schüler mußte in jedem Fach einmal pro Halbjahr einen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema aus dem behandelten Stoffgebiet halten. Man hatte damit sehr gute Erfahrungen gesammelt, denn auf diese Weise lernten die Schüler frühzeitig, selbständig ein Thema vertieft zu erarbeiten und dann in möglichst freier Rede coram publico vorzutragen. Und so war es inzwischen in allen Schulen des Landes zur Selbstverständlichkeit geworden.
„Es ist ja eigentlich schon verwunderlich, daß die Kinder, obwohl von denselben Eltern abstammend, trotzdem doch sehr verschieden sein können“, konstatierte Long. „Die Ursachen dafür herauszufinden, stelle ich mir fast so spannend wie einen Krimi vor – und der Mendel hat mit seinen Versuchen dafür die Grundlage geschaffen und entsprechende Regeln, die später nach ihm benannten Mendelschen Regeln, formuliert.“
„Wieso? Was hat der für Versuche gemacht?“ wollte Jiao wissen.
„Der hat in einem Klostergarten ganz systematisch eine große Reihe von Kreuzungen verschiedener Erbsenrassen durchgeführt und ausgewertet. Seine Beobachtungen, wie sich die unterschiedlichen Merkmale der Erbsenrassen, also zum Beispiel die Wuchsform, die Blütenfarbe oder die Gestalt und Farbe der Samen, auf die jeweiligen Nachkommen verteilten, hat er 1865 in einem Buch veröffentlicht. Seine Ergebnisse zeigten unter anderem die Häufigkeitsverteilung bei der Vererbung der unterschiedlichen Merkmale in einem ganz bestimmten Zahlenverhältnis, beispielsweise 1:2:1 oder 3:1, je nachdem, ob es sich um intermediäre oder dominant-rezessive Vererbung handelt.“
„Was muß ich darunter verstehen?“ fragte Jiao.
„Das zu erklären würde jetzt hier sicher zu weit führen, dazu müßte ich länger ausholen“, erwiderte Long.
„Ja toll – sehr interessant!“ unterbrach ihn Jiao etwas unwirsch, wobei sie besonders das „sehr“ betonte. „Ich verstehe zwar im Moment nur ‚Bahnhof‘, aber du kannst ruhig weiter dozieren. Auf mich brauchst du ja keine Rücksicht zu nehmen!“ Und es klang fast schon ein wenig beleidigt.
„Das lernst du auch alles noch in der Schule, mein Kind“, versuchte Chan ihre Tochter zu vertrösten. „Hab nur etwas Geduld.“
Jiao schien etwas genervt und verdrehte demonstrativ die Augen.
„Naja, ich will hier auch gar nicht in die Details gehen“, fuhr Long fort. „Jedenfalls gelten die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung für die ganze belebte Natur und damit eben auch für den Menschen, wie man durch Familien- und insbesondere auch Zwillingsforschung schon lange weiß. Auch beim Menschen gibt es dominante und rezessive Merkmale. Das zeigt sich besonders deutlich bei bestimmten Krankheiten oder Abnormitäten, aber auch bei charakteristischen Äußerlichkeiten oder Angewohnheiten.“
„Deine Angewohnheiten sind manchmal ganz schön lästig!“ platzte Jiao wieder dazwischen. „Von wem hast du die?“
Alle lachten.
„Zweimal darfst du raten!“ rief Jie lachend.
„Also, wenn ich mir unsere Familie so anschaue, dann habe ich den Eindruck, daß wir Drei“, und damit meinte Long seine Geschwister und sich, „uns ja auch erkennbar unterscheiden – und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch im Wesen, daß wir aber andererseits teilweise unübersehbar deutliche Ähnlichkeiten zu unseren Eltern aufweisen. Ich denke zum Beispiel, daß ich ganz offensichtlich eher nach Paps komme“, sagte Long, „während Jiao deutlich mehr von Mam geerbt hat. Bei Jie kann ich bisher keine klare Dominanz zur einen oder anderen Seite entdecken, er hat wohl von euch beiden ungefähr gleich viel mitbekommen.“
Читать дальше