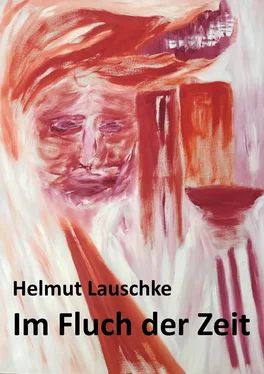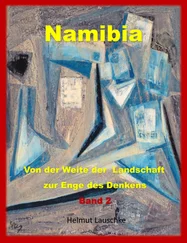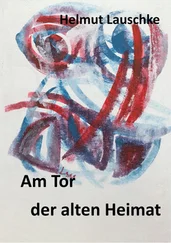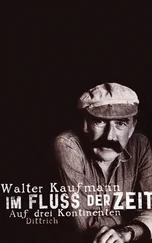Ich musste mich von dieser Einheit so schnell wie möglich absetzen. Dabei half mir die Tatsache, dass es bei den Deutschen Tote gegeben hatte, und der Untersturmführer mich unter den Toten wähnte und mir den Tod auch doppelt gönnte. Nur musste ich die schwarze Uniform über Nacht loswerden. Da auch Soldaten in grauen Uniformen bei der Erschießung waren, hoffte ich unter den erschossenen Deutschen eine noch tragbare Wehrmachtsuniform zu finden. Im frühen Morgen, dichter Nebel zog durch den Wald, fand ich zwei Tote in den gewünschten Uniformen. Ich wechselte meine gegen die ihre aus, vom einen die Hose, die Socken und Schuhe, vom andern das Hemd, die Jacke, den Mantel und das Koppel mit einigen Patronen in den Taschen. Auch wechselte ich das moderne Gewehr gegen ihr älteres aus. Das Aluminiumschildchen mit der Feldpostnummer entfernte ich vom Hals des Gefallenen und steckte es in die Jackentasche, in der außer einer halb leeren Zigarettenschachtel und einem Feuerzeug ein Brief der Eltern war, sodass ich mir zur Feldpostnummer auch den dazugehörigen Namen aneignete.
Es war die Gunst der Stunde, dass uns Spätgezogenen die SS-Nummer und die Blutgruppe nicht am Arm eintätowiert worden war. So saß ich in anderer Uniform mit dem durchschossenen Fuß am Straßenrand auf einer Holzkiste, die links mit Sand und rechts mit Streusalz gefüllt war. Ich versuchte zu gehen, doch nach hundert Metern hielt ich es vor Schmerzen nicht aus. So wartete ich auf ein Militärfahrzeug, um mitgenommen zu werden. Ich saß auf einer Anhöhe, von der ich die Kurven der ansteigenden Straße gut übersah. Es kamen Fahrzeuge der SS. Denen musste ich aus dem Blickfeld gehen und hockte mich hinter die Sand- und Streusalzkiste. Dann kam ein Sanitätsauto. Ich setzte mich auf die Kiste, zog, als das Fahrzeug mit Mühe die zweite Kurve nahm und etwa vierhundert Meter von mir entfernt war, das braun gestreifte Taschentuch aus der Manteltasche, das dem Gefallenen mit dem Brief und der Feldpostnummer gehörte, und winkte dem Fahrer entgegen. Der hielt an, sah den durchbluteten Notverband, rief “Komm Kumpel!”, öffnete die Ambulanztür, und ich stieg ein. Er stieg nach, legte mich auf die schmale Trage, entfernte den verdreckten Verband, säuberte die Wunde mit Spiritus, legte fachmännisch den neuen Verband an und gab die Tetanusspritze.
Der Sanitäter war ein kräftiger Mann. Er sagte, dass er ein Kumpel von der Ruhr sei. Er bot mir einen Schnaps aus der Flasche an, brach einen größeren Kanten von seinem Brot und gab ihn mir. Er sagte, dass er auf dem Weg nach Krakau sei, wo er Verwundete mit Kopfverletzungen laden müsse, die nach Breslau gebracht werden sollen. Der Kumpel von der Ruhr war ein ungewöhnlicher Mensch. Er stellte keine Fragen, als hätte er gesehen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich sagte ihm, er solle mich mit meiner Verwundung nach Breslau fahren. Darauf sagte er: “Kumpel, du brauchst deinen Fuß. Das sehe ich ein.” Er schloss die Ambulanztür, startete den Motor und fuhr davon. Unterwegs hielt er mehrere Male an. Doch passierte er die Straßenkontrollen ohne Schwierigkeit. Nach einer dieser Kontrollen hielt er an, kam in die Ambulanz und sagte: “Junge, jetzt müssen wir aufpassen, denn nun sind die Goldfasane auf den Straßen.” Er legte mir einen Kopfverband an, der über beide Augen ging, und beschmierte ihn mit dem Blut der Fußwunde. Am späten Nachmittag erreichte das Fahrzeug das Notlazarett in Krakau. Zwei Verletzte mit Kopfverbänden wurden geladen. Einer kam auf die Doppelstocktrage, der andere wurde auf einer dritten Trage reingeschoben. Nachdem der zweite Verletzte auf der Zusatztrage reingeschoben worden war, fragte der Sanitäter nach meinem Namen und der Feldpostnummer. Beides, was dem Gefallenen von Lublin gehörte, gab ich an. Der Kumpel von der Ruhr setzte Name und Nummer zu den Namen und Nummern der beiden Kopfverletzten, deren Transportpapier der Kommandeur bereits unterschrieben hatte. So ging die Fahrt noch am selben Abend nach Breslau weiter, die von zahlreichen Straßenkontrollen in der Nacht unterbrochen wurde.
Jedesmal klopfte der Fahrer, wenn er die Schranke über die Straße sah, kräftig gegen das Blechgehäuse der Ambulanz; jedesmal knipsten wir das Licht aus, sprangen auf die Tragen, wo ich mir meinen blutverschmierten Kopfverband über die Augen ins Gesicht zog. Einmal kam das Klopfen zu spät. Der Kumpel war übermüdet. Nach einer scharfen Bremsung kam das Fahrzeug zum Stehen. Ich knipste das Licht aus. Wir drei lagen auf den Tragen, jeder mit seinem Kopfverband. Die Wachleute befahlen dem Kumpel, die Ambulanztür zu öffnen. Sie sagten, als sie die dunkle Ambulanz mit den drei Verletzten auf den drei Tragen ausleuchteten, dass sie hier Licht gesehen hätten, als das Fahrzeug angefahren kam. Der Kumpel sagte, dass er ab und zu das Licht anstelle, um zu sehen, dass die Verletzten noch so liegen, wie sie auf den Tragen in die Ambulanz hineingeschoben wurden. Es schien den Wachleuten plausibel, die noch einige Male die Verletzten ableuchteten und beim Anblick meines dicken und über die Augen gezogenen Kopfverbandes ihr medizinisches Gutachten mit den Worten abgaben, dass bei dem wohl kaum Chancen bestehen, mit dem Leben davonzukommen. Beim Schließen der Tür fiel dem jüngeren der beiden Wachleute die herumliegende Pik-zehn-karte neben der dritten Trage auf. Er fragte den Sanitäter, ob Kopfverletzte denn auch Skat spielen können. Es war die Schlagfertigkeit des Kumpels mit dem “Wohl kaum!”, dass die Wachleute von einer gründlichen Inspektion absahen, weil sie keinen Verdacht der Täuschung schöpften. Ihre Intelligenz brachte die Verbindung von der Skatkarte zum brennenden Licht in der Ambulanz nicht auf die Beine, sodass wir drei noch einmal ungeschoren davonkamen, als der Sanitätswagen nach Öffnen der Schranke davonfuhr. Doch der Kumpel hinter dem Steuer rief laut, dass man es hinten hörte: “Ihr Idioten, ich habe euch doch gesagt, dass ihr aufpassen sollt.”
Klaus merkte an der stillen Aufmerksamkeit der Zuhörer, dass seine Soldatengeschichte auf offene Ohren stieß. Er fuhr fort: “Nachdem wir etwa zehn Kontrollen passiert hatten, bei denen es, je näher wir an Breslau herankamen, SA-Leute sich an den Wachen beteiligten. Die nahmen sich besonders wichtig, ließen sich bei der Kontrolle besonders viel Zeit und leuchteten die Ambulanz und uns auf den Tragen mit dem eingefleischten Misstrauen des Systems des Bösen ab. Sie schienen den Kopfverbänden nicht zu trauen und leuchteten sie von allen Seiten mit großer Hartnäckigkeit ab. Sie fragten nach den Namen und verglichen sie mit den Eintragungen auf dem Transportpapier. Mich stupsten diese Kerle an, weil ich auf ihre Frage nicht reagierte. Ich versuchte, den Atem anzuhalten, solange es ging. Darauf sagte einer dieser Braunjacken mit der großen Swastika auf der roten Armbinde zum anderen: “Siehst du denn nicht, dass der nicht mehr atmet. Der ist bereits hinüber. Da kannst du lange auf eine Antwort warten. Komm, lass uns gehn!” Darauf schloss der Kumpel die Ambulanztür, schob den Riegel vor und hängte das Schloss ein.
Ich setzte meine Atmung wieder in Bewegung, und der Kumpel fuhr los. Bald pfiff er ein Liedchen der Erleichterung in seiner Kanzel, denn nun war Breslau nicht mehr weit. Der Morgen graute, als der Kumpel am Stadtrand hielt, die Ambulanztür öffnete und in den Raum rief: “Endstation! Wer aussteigen will, der soll es jetzt tun, denn nun geht es zum Lazarett.” Gustav entfernte seinen Kopfverband und stieg aus. Er sagte, dass er sich nach Görlitz durchschlagen wolle. Erwin hatte tatsächlich eine Platzwunde am Kopf und ich die Durchschusswunde am rechten Fuß. Ich entfernte den dicken Kopfverband und ließ mich mit Erwin zum Lazarett fahren, das im Stadtkrankenhaus untergebracht war. Der Kumpel fuhr durch die Einfahrt bis an den Eingang heran. Während wir auf Tragen mit Rollen verladen wurden, ließ sich der Sanitäter, der sich als wirklicher Kumpel zeigte, das Transportpapier von einem Offizier abzeichnen und mit dem Lazarettstempel versehen.
Читать дальше