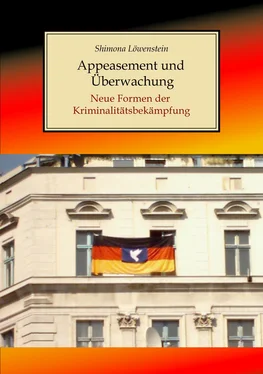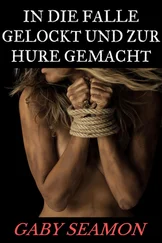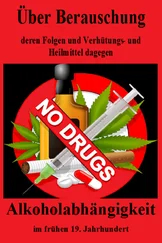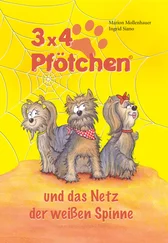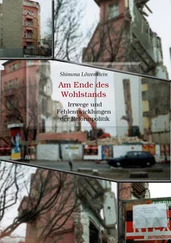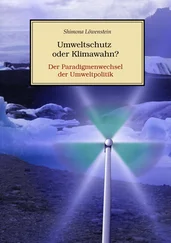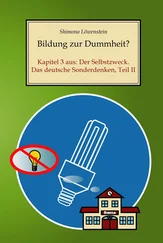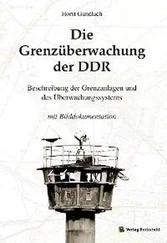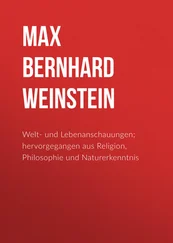Um ethisch bewußte Menschen zu erziehen, ist es angebracht, den Kindern zu zeigen, was falsch und was böse ist, und wie sie mit ihren Gefühlen, Neigungen und Trieben umzugehen lernen, anstatt die angeborene Kampflust oder Aggression an sich zu verpönen oder zu verleugnen. (Man könnte sich fragen, ob die Antigewalt-Verkünder jemals Märchen oder Sagen gelesen haben, die von Gewalt voll sind und wo sie oft die einzige Möglichkeit bildet, das Böse zu bekämpfen.) Eigentlich müßten es die Psychologen besser wissen, daß unsere Triebe, auch die aggressiven, nicht verdrängt werden dürfen, da sie sonst zu einem späteren Zeitpunkt unkontrolliert wiederkehren. Somit müssen auch Kampfhandlungen (Raufereien oder Kampfspiele) auf irgendeine Art ausgelebt werden, um später bewußt kontrolliert zu werden. Eine Erziehung, die Kinder von jeder Form auch spielerischer Kampfhandlung fernhält und alles, was irgendwie mit „Gewalt“ zu tun hat (wie Spielzeugwaffen, elektronische Kriegsspiele oder Filme mit Gewaltszenen) völlig unterbindet, programmiert Spätfolgen , die auf verdrängte, nicht bewußt gewordene und damit unkontrollierte Aggressionen sowie auf Frustrationen zurückzuführen sind, die im wirklichen Leben zwangsläufig auftreten, mit denen das Kind aber nicht umzugehen gelernt hat.
Überdies unterstellt die Vorstellung, daß Gewalt an sich das eigentlich Böse sei, das man mit allen Mitteln vom Kind fernhalten müsse. Nicht mehr Selbstsucht, Hab- und Machtgier, Hinterhältigkeit, Feigheit und sonstige traditionell als schlecht oder böse geltende Eigenschaften oder Verhaltensweisen werden in der neuen Pädagogik thematisiert, sondern allein Gewalt als Übel schlechthin bekämpft. Mit der Behauptung, daß jede Gewaltanwendung falsch ist, ignoriert aber die alternative Erziehung, trotz der allmählichen Abschwächung des ursprünglichen antiautoritären Aufbegehrens, auch die angeborenen Instinkte und Eigenschaften, deren Sinn sie mißversteht: In ihrer Sicht stellt Gewalt nur eine falsche Reaktion auf vorhergehende Gewalt dar, auf die niemals mit Gleichem reagiert werden darf. Gewalt als Abwehr oder Gegenmaßnahme gilt dagegen als verfehlt. Daß Gewalt nur ein Mittel ist, etwas zu erreichen oder zu bekämpfen, über dessen geeignete Verwendung sich diskutieren läßt, liegt jenseits des Denkmusters der „gewaltfreier Erziehung“. Die Verteufelung von Gewalt stellt hier nur das negative Spiegelbild deren früheren Verherrlichung dar: In beiden Fällen wird nicht ausreichend zwischen Mittel und Zweck unterschieden. Mit der Gleichsetzung des Guten mit dem Friedlichen und dem Bösen mit Aggression nach dem Deutungsmuster dieses reduzierten Menschenbilds erfährt aber die herkömmliche Vorstellung von Gut und Böse eine Umdeutung, die weiter geht als zur bloßen Relativierung. Sie hat unvorhergesehene Folgen, wie eine Verzerrung des Gerechtigkeitssinns und Diskrepanzen in der Rechtspraxis. Dadurch bekommt der ursprünglich relativistische Verzicht auf Wertevermittlung ein ideologisches Gesicht; dementsprechend kann sich die Antigewalt-Pädagogik aus hilfloser Duldung oder Bekehrungsversuchen zum Gewaltverzicht in eine neue Art von Hexenjagd verwandeln. Vor diesem Hintergrund der Gewaltbekämpfung um jeden Preis erwachsen Maßnahmen, die aus einer anderen Tradition stammen, nämlich dem Rückgriff auf gesetzliche Einschränkungen des Elternrechts, auf Verbote, Überwachung und Zensur.
Die „gewaltfreie Erziehung“, die sich zwar in der pragmatischer denkenden Bevölkerung keineswegs immer durchgesetzt hat, weist schwere theoretische Fehler auf, die in der Praxis zu unerwünschten, ja dem Anliegen entgegengesetzten Folgen führen können. Ihr Versagen gründet darin, daß sie
1 bestimmte Teile der menschlichen Natur, deren Funktion sie nicht versteht oder mißdeutet, ignoriert oder bekämpft,
2 erzieherische Maßnahmen mit Gewalttätigkeit verwechselt,
3 durch Vermeidung von Konflikten, Abwesenheit von Widerständen und Verzicht auf Strafen falsche Signale setzt und damit
4 das einzige Prinzip, das eine angemessene Selbsteinschätzung, eine realistische Bewertung der eigenen Handlungen und damit Gewissens- und Persönlichkeitsbildung ermöglicht, mißachtet,
5 keine Orientierung liefert und ethische Wertvorstellungen durch kulturellen Relativismus oder Ideologie ersetzt.
Das bedeutet zwar nicht, daß der Verzicht auf (körperliche) Strafen in der Praxis Gewalt selbst herbeiführt; die Dogmen der „neuen Erziehung“ verhindern aber eine unvoreingenommene Einsicht in die tatsächlichen Ursachen von Gewalt, Kriminalität und Extremismus und den Umgang mit ihnen. Mit den damit verknüpften Tabus versetzt man die ganze Gesellschaft in eine prekäre Lage, in der sie außerstande ist, der vorhandenen Gewalt der Jugendlichen, einschließlich der Neonazis oder der jungen Islamisten, etwas entgegenzusetzen oder ihr effektiv entgegenzuwirken.
1.1. Sündenböcke: Soziale und familiäre Umstände, Unterhaltungsindustrie
Auch bei der Suche nach Ursachen der Gewalt tauchen dieselben Schemata und Sündenböcke auf wie beim Schulversagen: Es sind entweder schlechte soziale oder familiäre Umstände (Arbeitslosigkeit, mangelnde Integration von Ausländern, zerrüttete Familien bzw. autoritäre, mit körperlicher Züchtigung verbundene Erziehung) oder eine übermäßig konsumierte Unterhaltungsindustrie (Gewalt in Film und Fernsehen, elektronische Kriegsspiele).
Die soziale Lage ist ein übliches Erklärungsmuster, das zwar auch heute von Bedeutung ist, aber in einem wohlhabenden Land kaum Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Auf jeden Fall stammen die Täter nicht immer aus der Unterschicht, sondern haben oft einen ordentlichen familiären Hintergrund. Da Hunger und Armut als Ursache für Kriminalität nur in seltenen Fällen in Frage kommen, wird heute eher allgemein von „Orientierungslosigkeit“ gesprochen, die gerne bei Jugendlichen im Osten diagnostiziert wird. Daß diese Orientierungslosigkeit ebensogut eine Folge „antiautoritärer Erziehung“ sein könnte, also des Unvermögens, auf bestimmte Verhaltensweisen deutlich und angemessen zu reagieren und bestimmte Werte als gültige Maßstäbe fürs Leben zu postulieren, wird nicht in Betracht gezogen. Meist wird nur in entrüstetem Ton über die Notwendigkeit einer Bekämpfung von Gewalt und Rechtsextremismus der Jugendlichen gesprochen, ohne diese Orientierung selbst bieten zu können. Erst allmählich dämmert es den Verantwortlichen, daß man der orientierungslosen Jugend doch bestimmte Wertvorstellungen oder zumindest eine Leitvorstellung vom richtigen Handeln vermitteln müsse. Das Mittel dazu glaubt man in der Einführung des Ethik- bzw. Werteunterrichts gefunden zu haben.
Zum Schuljahr 2006/2007 wurde z.B. in Berlin an öffentlichen Schulen in den Klassenstufen 7-10 das Pflichtfach Ethik eingeführt. Die Entscheidung wurde im allgemeinen akzeptiert, ohne sich bewußt zu werden, daß man Sittenlehre mit den Schulreformen längst als spießig abgeschafft hatte; man stritt lediglich darüber, ob sie mit oder ohne Zensuren unterrichtet werden sollte, da es möglich ist, daß hier statt „Leistung“ die „korrekte Meinung“ benotet wird. [5] In vielen Fächern (wie Geschichte, Sozialkunde, Politische Weltkunde u.a.) ist Leistung ebenso strittig und nicht eindeutig meßbar. Nichtsdestoweniger wurden Verfassungsbeschwerden gegen die Einführung von Ethik als Pflichtfach eingereicht. Die Initiative Pro Reli e.V. brachte einen Volksentscheid zuwege, über den am 26. April 2009 abgestimmt wurde. [6]
Die Argumente der Initiative waren für die Mehrheit der Bevölkerung wenig überzeugend. In ihrem Gesetzesentwurf sollten Religion, Weltanschauungsunterricht und Ethik, wie in anderen Bundesländern, als gleichberechtigte Pflichtfächer in der Schule gelten. In der Praxis bedeutete es jedoch, daß die Möglichkeit, beide Fächer zu belegen, wegfallen würde, und daß Kinder aus religiösen Familien, also auch die meisten muslimischen Kinder, in der Regel überhaupt nicht am Ethikfach teilnehmen würden. Behauptungen, daß man mit der Einführung des Ethikunterrichts „die Chance, ein ganzheitliches Konzept der Schule als werteorientierter Lebens- und Erfahrungsraum für unsere Kinder zu gestalten“, verpasse, und das Fach Ethik ein umfassendes Religionswissen von verschiedenen Religionen nicht bieten könne, sind umstritten. Die Forderung nach strikter Trennung von Kirche und Staat als überholt und die Mitwirkung von Religionsgemeinschaften in öffentlichen Schulen als Vorbeugung gegen Radikalisierung war der Mehrheit (insgesamt 51,3 %, in östlichen Bezirken sogar über 70 %) nicht zu vermitteln. [7]
Читать дальше