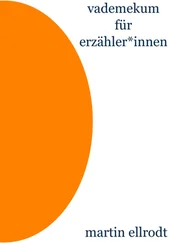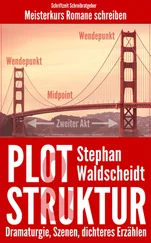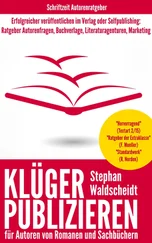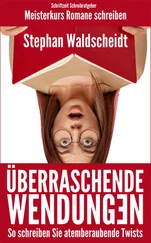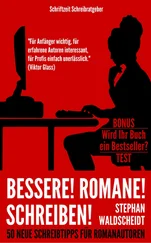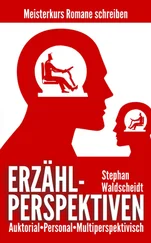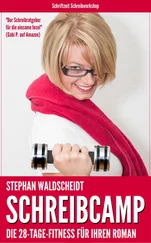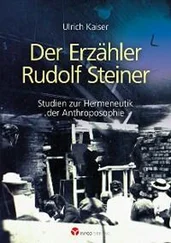Ilsebill salzte nach.
(Günter Grass, »Der Butt«, Luchterhand 1977)
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.
(Franz Kafka, »Die Verwandlung«, Verlag der Weißen Bücher 1915)
Entweder mache ich mir Sorgen oder was zu essen.
(Ildikó von Kürthy, »Blaue Wunder«, Rowohlt 2005)
In der Mottengasse elf, oben unter dem Dach hinter dem siebten Balken in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher Herr Gleisenagel wohnt, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste.
(Janosch, »Lari Fari Mogelzahn«, Beltz 1998)
In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff, das in schwerer See hin- und hergeworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern.
So klingen Hexen, wenn sie brennen, dachte Vera, oder Kinder, wenn sie sich die Finger klemmen.
(Dörte Hansen, »Altes Land«, Penguin 2016)
Noch berühmter, aber eben hier nur Übersetzungen, sind diese Anfänge:
Nennt mich Ismael.
(Herman Melville, »Moby Dick«, englisches Original von 1951)
Es war die beste und die schlimmste Zeit, ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis: es war der Frühling der Hoffnung und der Winter der Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten nichts vor uns; wir steuerten alle dem Himmel zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung – mit einem Wort, diese Zeit war der unsrigen so ähnlich, dass ihre geräuschvollsten Vertreter im guten wie im bösen nur den Superlativ auf sie angewendet haben wollten.
(Charles Dickens, »Eine Geschichte aus zwei Städten«, Insel 1987, engl. Original von 1859)
Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Meine Sünde, meine Seele. Lo-li-ta: die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta.
(Vladimir Nabokov, »Lolita«, Rowohlt 1959, 2007)
Er war ein alter Mann und er fischte allein in einem Boot im Golfstrom, und seit vierundachtzig Tagen hatte er keinen Fisch gefangen.
(Ernest Hemingway, »Der alte Mann und das Meer«, Rowohlt 1952)
In all diesen Beispielen gibt der Erzähler dem Leser des Romans mehr mit als nur den Inhalt des Geschriebenen, selbst in scheinbar »stimmenlosen« Anfängen wie bei Hemingway oder Grass. Erst im Vergleich der so unterschiedlichen Texte erkennt man, dass es einen stimmlosen Erzähler nicht gibt. Auch die Wortwahl definiert ihn und diese Wahl meint eben nicht nur die Entscheidung zwischen Synonymen. Sondern die Auswahl dessen, was er überhaupt schildert, bei Grass etwa die Idee, dem Leser als Erstes eine Frau beim Nachsalzen zu präsentieren.
Der Erzähler ist die eigentliche, die wahre Hauptfigur Ihres Romans– selbst wenn er nur eine Nebenrolle spielt wie Nick in »Der große Gatsby« oder gar nicht darin vorkommt. Denn das, was beim Leser ankommt, wurde vom Erzähler schon interpretiert und kuratiert. Das geschieht mal ganz offen, etwa bei auktorialen Erzählern oder bei personalen (auch: figurengebundenen) Erzählern mit einer Stimme, die sich nicht versteckt. Oder es geschieht klammheimlich, wenn der Erzähler scheinbar hinter der Geschichte verschwindet. Wie oben in dem Beispiel aus »Der Butt«. Dabei verschwindet der Erzähler nicht, der Leser soll das nur glauben. Dieser Trick gaukelt Objektivität vor, wo in Wahrheit Subjektivität herrscht. Jedes Wort ist eine subjektive Entscheidung des Erzählers– für dieses Wort, das er allen anderen vorzieht, die an der Stelle ebenfalls hätten stehen können.
Der Erzähler ist das Erste, was Ihr Leser vom eigentlichen Roman wahrnimmt(nach Cover mit Klappentext/Blurbs und Titel). Genauer gesagt: seine (oder ihre) Stimme. Ja, der Inhalt Ihrer ersten Sätze ist wichtig. Doch die Stimme , die diesen Inhalt überbringt, ist ebenso bedeutsam.
Eine starke Stimme, die den Leser sofort überzeugt, die ihn in den Roman einlädt und ihn seinen Unglauben ablegen lässt (»Ich weiß, es ist nur eine Geschichte, aber für die Dauer des Buchs tue ich so, als würde ich sie glauben.«), eine solche Stimme kann eine inhaltlich wenig bemerkenswerte erste Seite zu etwas Besonderem erheben. Zu etwas, was den Leser einfängt und ihn, falls noch nicht geschehen, zum Käufer Ihres Buchs werden lässt.
Es gibt dazu keine Alternative. Weil es den stimmlosen Erzähler nicht gibt.
Was es gibt, sind extrem sprachunempfindliche Leser. Doch auf diese sollten Sie sich nicht verlassen und sie nicht unterstützen. Weil sie langfristig das Ende der Literatur bedeuten.
Der Erzähler kann identisch mit einem Protagonisten sein (personaler Erzähler), er kann auch außerhalb der Geschichte stehen (auktorialer Erzähler). Oder er kann in den Hintergrund verschwinden, indem er sich unsichtbar macht.
Übrigens ...
Sowohl in der Erzähltheorie als auch in Büchern zum kreativen Schreiben werden die Begriffe auktorialer und personaler Erzähler nicht einheitlich verwendet. Ich gebrauche sämtliche Begriffe möglichst praxisbezogen, also so, dass Sie als Autor die Ausführungen leicht nachvollziehen und gut damit arbeiten können.
Erzähler heißt auf Englisch narrator. Das Creative Writing verwendet daneben das Wort persona(eigentlich »Rolle« sowohl im sozialen Kontext als auch im Schauspiel). Dieses Wort verdeutlicht besser, dass ein Roman mehrere Erzähler haben kann, dass also der Autor in mehrere Rollen schlüpft, um die Geschichte zu erzählen.
Persona meint zugleich das » lyrische Ich« und grenzt damit den Erzähler vom Autor ab, gerade (aber nicht nur) wenn er in der Ich-Form schreibt. (Das »lyrische Ich« ist ein in der Literaturwissenschaft umstrittener Begriff. Was uns hier nicht zu kümmern braucht, weil wir Praktiker sind.) Für einen Roman könnten wir einen Erzähler das » prosaische Ich« oder das » narrative Ich« nennen.
Übrigens ...
Der Einfachheit halber schreibe ich meistens »der Erzähler«. Diese Bezeichnung verwende ich als Platzhalter für Erzähler jedweden Geschlechts, aber ebenso für Erzähler eines Romans oder, bei multiplen Erzählern, dem Erzähler des jeweiligen Erzählstrangs.
So weit, so gut. Der Erzähler ... erzählt. Aber was meinen wir beim Schreiben eines Romans überhaupt mit Erzählen ?
Im Roman selbst steht – im Kleinen – das Erzählen (die Narration oder das Telling) dem szenischen Schreiben (das Zeigen oder Showing) gegenüber. Dieses Erzählen ist ein Behaupten. Und sieht beispielsweise so aus:
Vor dem befestigten Lager lag ein langer Strand, der um die Bucht herum bis zum Mangrovensumpf führte. Auf der anderen Seite der Bucht machte der Strand einer felsigen Landzunge Platz, die einen schönen, natürlichen Hafen bildete. Unmittelbar vor dem Lager lag die Philipus unterstellte Bireme auf dem Sand. Der oberste Zimmermann hatte dem alten Kriegsschiff viele Monate Arbeit gewidmet. Er und seine Männer hatten angefaultes Holz ersetzt, das Schiff geteert und den Mast, die Spieren und die Takelage erneuert. Nahe dem Bug waren zu beiden Seiten kunstvoll Augen aufgemalt worden.
Anders die szenische Darstellung. Darin werden die Ereignisse dem Leser vor Augen geführt, ihm gezeigt und damit bewiesen:
Als Philipus bei dem kleinen Wachturm eintraf, betrat er die Wachstube im Untergeschoss und sah drei seiner Marineinfanteristen auf Bänken sitzen. Sie aßen Brot mit getrocknetem Fisch und unterhielten sich dabei in leisem Tonfall. Als sie ihn erblickten, standen sie auf und salutierten.
Читать дальше