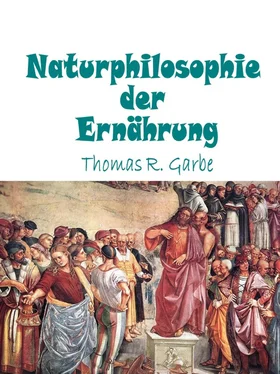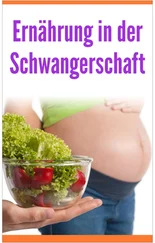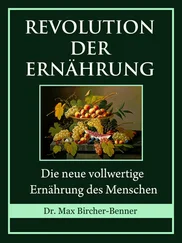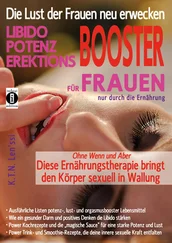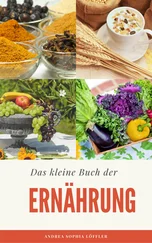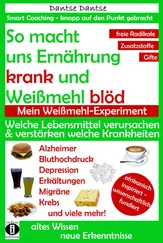Ein dramatisches Beispiel für die Toxizität naturfremder Verbindungen ist das neurotoxische und hoch-teratogene Contergan (Tab. II-4). Contergan erschien strukturell unverdächtig und lässt sich elegant und umweltfreundlich synthetisieren. Es wurde bis 1961 in deutschen Apotheken als rezeptfreies Schlafmittel in Dosen von 25 bis 100 mg pro Tablette vertrieben – und auch als Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit. Ein Teil des Contergan-Moleküls, der Glutarimid-Rest, ist unproblematisch, da er in dem jahrzehntelang eingenommenen narkotischen Schlafmittel Doriden keine auffälligen Nebenwirkungen verursacht hat. Dagegen bewirkt der gänzlich naturfremde xenobiotische Phthalimid-Rest die Wandlung zu einem Neurotoxin von katastrophaler Teratogenität:
"Je nach dem Zeitpunkt der Einnahme [des Contergans] störte es die Ausbildung der Extremitäten, des Schädels oder der inneren Organe. Waren lebenswichtige Organe betroffen, starb der Embryo ab; hemmte das Thalidomid [Contergan] die Entwicklung der Extremitäten, kamen fehlgebildete Kinder zur Welt. 1958 wurden 24 geschädigte Kinder geboren, die Zahl schnellte im Jahr 1961 auf 1.515 hoch, um ein Jahr später wieder auf knapp 1.000 zu sinken. In Deutschland wurden ungefähr 5.000 Kinder mit Contergan-Schäden geboren, bis heute haben 2.500 Menschen mit zum Teil schwersten Fehlbildungen überlebt.” (Thomann 2007).
Auch die weithin als PVC-Weichmacher verwendeten Phthalsäure-Ester (Phthalate) sind teratogen, aber sie werden nicht als Arzneimittel verwendet, so dass die individuelle Exposition gering bleibt. Doch auch eine geringe Phthalat-Exposition wird als problematisch angesehen, da Phthalate, wie viele andere Xenobiotika, hormonähnliche Wirkungen haben können. Die Verwendung von Phthalsäure-diethylester (Diethylphthalat) als Fixateur in Parfüm erscheint jedenfalls unnötig riskant. Das trotz seiner unbestrittenen Karzinogenität seit langem verwendete fungizide Phthalimid Folpet (N-(Trichloromethylthio)phthalimid) scheint erst bei hohen akut-toxischen Dosen dauerhafte Folgen für die Leibesfrucht zu verursachen.
Erneut auffällig wurde der Phthalimid-Rest durch seine Verwicklung in die katastrophale Neurotoxizität des als Insektizid verwendeten Phosmet. Dieses Organophosphat (Tab. II-4) wurde mit guten Gründen – und entgegen den offiziellen Behauptungen, für den Rinderwahnsinn (BSE) verantwortlich gemacht (Purdey 1998). Der Wissenschaftler und Bio-Bauer Mark Purdey (1998) stellte fest, dass seine am Bio-Hof großgezogenen Rinder von der degenerativen Nervenerkrankung BSE verschont blieben, nicht aber zugekaufte Rinder, die im Mutterleib, damaliger britischer Vorschrift entsprechend, hochdosiertem Phosmet ausgesetzt worden waren. Phosmet ist ein insektizides Organophosphat, das durch den gemeinsamen Phthalimid-Rest mit Contergan verwandt ist (Tab. II-4).
Der phantastischen offiziellen Theorie gemäß soll BSE durch infektiöse Proteine (Prionen) verursacht werden. Die pathogenen Prionen sollen von spontan erkrankten, genetisch-degenerierten Zuchtschafen stammen, deren Schlachtabfälle zu Futtermitteln für Rinder verarbeitet wurden. Das Problem mit dieser Theorie ist die Tatsache, dass die inkriminierten Futtermittel in die ganze Welt verkauft wurden, der Rinderwahnsinn aber nur in einigen wenigen Ländern auftrat, darunter an einsamer Spitze in Großbritannien mit 150.000 BSE-Fällen (Purdey 1998). An einsamer Spitze war auch der britische Verbrauch von dem phthalimidhaltigen Organophosphat Phosmet (Tab. II-4), das den Rindern ab Ende der 1970er Jahre systemisch verabreicht werden musste. Dazu wurde Phosmet als hochdosierte ölige Lösung halbjährlich auf dem Rücken entlang der Wirbelsäule verrieben – in einer landesweiten Anstrengung zur Ausrottung der parasitären Dasselfliege (Purdey 1998).
Die außergewöhnliche Gefährlichkeit des Contergans lässt den Eifer mancher Individuen merkwürdig erscheinen, Contergan erneut als Medikament zu verwenden, sowie neu entwickelte Phathalimid-Verbindungen (Apremilast, Pomalidomid) in die Heilkunde einzuführen ‒ wenn auch für schwerwiegendere Indikationen. Neben schamlosem Profitstreben scheint dahinter das Bemühen zu stehen, Reputation, Image und Ideologie der synthetischen Pharmazie aufzuwerten, sowie das persönliche Selbstverständnis abzuschirmen vor der als peinlich bewerteten Einsicht in die integrale Abhängigkeit des Menschen vom Leben auf der Erde, dem Gegenteil der seit langem als progressiv propagierten morbiden Dekadenz judaeo-christlicher Kultur (Nietzsche 2008).
Naturfremde synthetische Chemikalien sollten immer nur vorübergehend eingenommen werden, oder als Ultima Ratio, wenn durch die Einnahme eines spezifischen Enzyminhibitors das Leben glaubwürdig noch einige Monate lebenswert weitergeführt werden kann. Allerdings behaupten die Autoren Abel (1995), Ellis et al. (2015) und viele andere, dass die chemotherapeutische Intervention selten etwas Gutes für die Patienten bewirkt.
Die fundamentale Alternative zu den chemischen Arzneimitteln ist der radikale Wandel des Lebensstils. Das lässt sich am Beispiel des Typ 2 Diabetes besonders leicht einsehen: Das entscheidende Ziel der Diabetesbehandlung ist die Normalisierung des erhöhten Blutglukosespiegels. Ernährungstherapeutisch logisch ist daher eine Diät, die so weit wie möglich auf Kohlenhydrate verzichtet. Der physiologische Bedarf an Kalorien muss dann durch einen höheren Verzehr von Fett und Protein gedeckt werden; erlaubt sind auch Blattgemüse, da sie wenig verdauliche Kohlenhydrate enthalten. Diese ketogene Diät ( siehe Abschnitt IV) soll sich bewährt haben, um innerhalb von wenigen Wochen seine Insulinsensitivität wiederherzustellen, und somit ohne Insulin und Medikamente seinen Blutglukosespiegel zu normalisieren (Paoli et al. 2013; Atkins 1999). Die antidiabetische Wirksamkeit der ketogenen Diät ist logisch unmittelbar einleuchtend und gilt als empirisch belegt, so dass jede dagegen laufende Empfehlung als irrationalistisch bewertet werden muss.
Praktisch beruht eine ketogene Diät für Diabetiker und andere chronisch Kranke auf hohem Fleischverzehr, was Vegetarier in ein Dilemma bringt. Als Ausweg deklarieren sie durchaus vorhandene Unterschiede zwischen den stärkereichen Lebensmitteln für wesentlich, bei deren Berücksichtigung eine Normalisierung des Blutzuckers gelänge (Dufty 1975). Für diabetesgerecht erachten sie oftmals Naturreis und Hafer, während sie Weizen und Kartoffeln eher verteufeln.
Dem sympathischen Eifer für eine heilende Ernährung fehlt hier nur leider die Logik, da auch Reis- und Hafer zur Glukose verdaut werden, die der Typ 2 Diabetiker wegen seiner Insulinresistenz nicht verwerten kann ‒ und mühsam durch die Nieren ausscheiden muss. Nicht ohne Zorn ist auf die Krankenhäuser zu verweisen, die es wider den gesunden Menschenverstand und entgegen empirischer Befunde unterlassen, ihre diabetischen Patienten auf eine ketogene Diät umzustellen, und einzig auf Medikamente und Insulin setzen.
Die allgemein gesunde Diät beginnt mit dem unsentimentalen Verzicht auf Süßigkeiten. Diese essenzielle Forderung lässt sich mit steigendem Verständnis für die schleichende aber unentrinnbare Toxizität des Zuckers zunehmend leichter befolgen. Der Verzicht auf Zucker wird durch gleichzeitigen Verzicht auf Alkohol erleichtert, wenn nicht sogar erst ermöglicht. Es ist sicher kein Zufall, dass Alkohol ein Naturprodukt ist, das aus Zucker gebildet wird (Lustig et al. 2012). Der verwegene Philosoph Friedrich Nietzsche preist den Islam für sein striktes Alkoholverbot, und schilt das Christentum für die Einsetzung von Wein zum Sakrament. „Alkohol korrumpiert“, sagt Nietzsche, und meint damit, dass er eine Geisteshaltung fördert, die sich allzu leicht mit jeder Gemeinheit – sich selbst und anderen gegenüber – abfindet.
Конец ознакомительного фрагмента.
Читать дальше