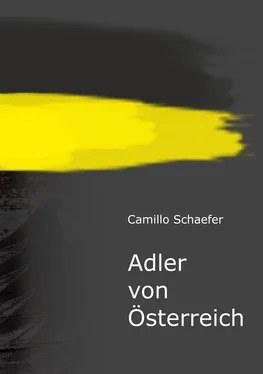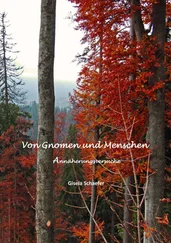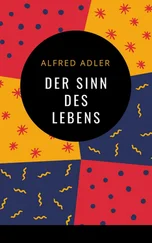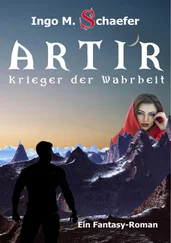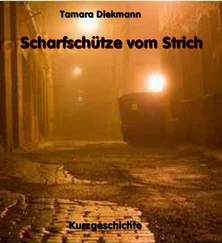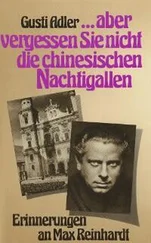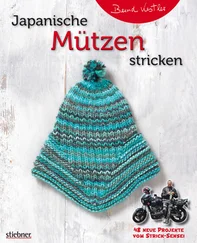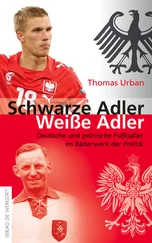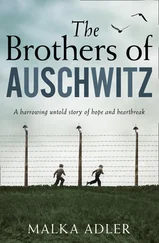Letzteres hob der schlaue Arpad Papp in seinem Exklusivbericht, der in Ödenburg allgemein begeisterte Zustimmung fand und in allen Wein- und Bierhäusern sowie auf Straßen und Plätzen als fettgedruckte Sonderausgabe feilgeboten wurde, ganz besonders hervor.
Plötzlich zu einem Markenzeichen geworden, lüftete man im Städtchen vor ihm schon von weitem den Hut, sprach ihn mit Herr an, gab ihm den Platz seiner Eltern in der Kirchenbank wieder und lud ihn beim Frühschoppen gern zu sich an den Tisch.
3. Kapitel
Die Rede, mit der Franz Joseph I. noch im selben Jubeljahr den Reichsrat eröffnete, wovon Papp natürlich wieder berichtete, war freilich, dem feierlichen Anlass gemäß, geradezu vor unechter Zuversicht übergeflossen:
"Nach wechselvollen Schicksalen und schweren Kämpfen steht Österreich, im Inneren sich verjüngend, nach Außen Achtung gebietend da, auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens sind die Schranken, welche der freien Bewegung hemmend entgegenstanden, beseitigt und die Wege betreten, welche zur Lösung der großen Aufgabe führen: Zur Einigung der Völker Österreichs zu einem mächtigen, von den Ideen des Rechtes und der Freiheit getragenen Staate."
Offiziell stand es um die Monarchie somit bestens.
In Wahrheit jedoch hatte schon der Verlust der Lombardei nach dem Krieg von 1859, den der Kaiser zeitweilig selbst als glückloser Oberbefehlshaber geleitet hatte, nicht nur eine Lockerung des Neoabsolutismus ratsam erscheinen lassen, sondern, gleichsam im Nebeneffekt, eine schleichende Lähmung der Wirtschaft bewirkt. Produktion und Absatzmärkte stagnierten, Staatspapiere und Aktien schwankten wie die sprichwörtlich gewordenen Rohre im Wind - der überaus peinlichen, absoluten Geldknappheit wegen war sogar die staatliche Südbahn in Privathand übertragen worden.
Nach dem bösen Ausgang des "Bruderkampfes" gegen Preußen deutlich vor Augen, das, mit Italien und Frankreich verbündet, Österreich bei Königgrätz eine schwere Niederlage zugefügt hatte, waren - realpolitisch gesehen - außerdem sämtliche Hoffnungen auf eine deutsche Politik unter einer Führung Habsburgs unweigerlich dahingeschmolzen, die ohnehin in periphere Sphären gerückte Vorstellung eines Kaisers und Reichs damit unweigerlich ausgeträumt, Venetien damit ebenso verlorengegeben wie die äußerst vagen Pläne einer etwaigen europäischen Neuordnung unter Österreich-Ungarn.
Rückblickend gesehen verdankten die Hohenzollern jedoch einzig der persönlichen Dominanz und Durchsetzungskraft Fürst Bismarcks die Gründung eines Kaiserreichs, das, wie Arpad Papp, der, überaus rasch steile Karriere machend, zum politischen Kommentator aufgerückt war, es trefflich formulierte, die traditionellen preußischen Gesellschaftsstrukturen trotz aller inneren Widerstände in die neue Zeit weiterzuführen wusste.
Schon der sich im Juli 1870 nach einer kurzen internationalen Krise entzündende Deutsch-Französische Krieg, mehr noch: - der schockartig erfolgte, militärische Zusammenbruch Frankreichs, hatte die überkommenen Spielregeln des europäischen Mächtesystems als hohle und brüchige Konventionen entlarvt. Die Entscheidung, die schwelende Rivalität über eine Vorherrschaft in Mitteleuropa durch einen Krieg auszutragen, dem der schicksalhafte Aufstieg Preußens zur kontinentalen Großmacht gefolgt war, ließe freilich, wie Papp - den nunmehr der in Budapest erscheinende, berühmte >Pester Lloyd< für teures Geld als Sonderkorrespondenten engagiert hatte -, es schwungvoll anzudeuten verstand, seither auch weitere militärische Lösungen durchaus im Lichte "praktikabler Möglichkeiten" erscheinen.
Nicht zuletzt vom Sog dieser dramatischen Wende, die Europa erfasst hatte, aufgescheucht, suchte die in einer Phase der Niedergeschlagenheit und suggestiven Friedensbereitschaft dahindämmernde österreichisch-ungarische Außenpolitik ein ihrer Großmachtstellung gemäßes, neues Betätigungsfeld, nachdem ihr - aus Italien hinausgedrängt -, vom Fall des Zweiten Französischen Kaiserreichs sowie der folgenschweren deutschen Reichsgründung faktisch jede weitere Aussicht auf eine künftige Wiederherstellung einer Hegemonie im Norden genommen war, wogegen das Debakel des maroden Staatswesens (bereits 1867) den so genannten >Ausgleich< zwischen Österreich und Ungarn herbeigeführt hatte.
Als zwingende Neuordnung angesehen, ohne der der Staat anhand seines permanenten Nationalitätenkonfliktes zu zerfallen drohte, sollte der Ausgleich die schwindende innere Stabilität gewährleisten. Gleichzeitig als politischer Gipfelpunkt des einsetzenden Liberalisierungsprozesses verstanden, für den sich die, wie Papp stets zu erinnern wusste, stark Magyaren-freundliche Kaiserin Elisabeth persönlich eingesetzt hatte, bedeutete der Ausgleich jedoch nicht nur die Auflösung einer unhaltbar gewordenen zentralistischen Reichseinheit, sondern entsprach de facto auch einer Aufteilung der Monarchie in die zwei Hauptstädte Wien und Budapest, zwei getrennten Parlamenten sowie einem Komplex von teils gemeinsam, teils getrennt geführten Ministerien und untergeordneten Behörden.
Während in der alten Kaiserstadt dem gehässigen Wortspiel "Österreich ist in den Ausgleich gegangen" noch Flügel wuchsen, waren die den Magyaren zugestandenen Sonderrechte, hauptsächlich in den böhmischen Ländern, wo man sich nicht zuletzt verständlicherweise als übergangen ansah, scharf kritisiert worden. Das leidige Nationalitätenproblem hatte sich aber noch mehr zugespitzt, seitdem die vollzogene >Versöhnung< mit Ungarn durch die feierliche Krönung des Kaiserpaars in Budapest ihren zeremoniellen Abschluss gefunden hatte, während eine ebensolche versprochene Krönung zu Königen von Böhmen weiterhin ausblieb.
"Die Krönung sagt uns", hatte seinerzeit hingegen hoch befriedigt das Hauptblatt der Deák-Partei kommentiert, "dass sich für Ungarn die Pforten einer neuen Zeit eröffnet haben, ohne dass es seine Vergangenheit aufzugeben brauchte..."
Seine Karriere inzwischen weiter vorantreibend, hatte Papp begonnen, die schwelende politischen Krise, die einen chronischen Charakter angenommen hatte, unentwegt als das >wohl fundamentalste Drama der Doppelmonarchie< zu thematisieren, ohne freilich irgendwelche reale Lösungsmöglichkeiten zu finden. Ein nahezu unbeschränktes Betätigungsfeld vorfindend, spießte er seine Feder in jene offene Eiterbeule, wann immer es galt, pünktlich seine ausgefeilten Berichte abzuliefern und im Gegenzug dafür großzügige Honorare sowie fette Spesenabrechnungen einzustreifen.
Sozusagen einen Gemischtwarenhandel auf Gegenseitigkeit betreibend, schrieb Papp, innerlich unberührt, ziemlich genau das, was für gutes Geld zu erwarten war.
Rasch zu einem Dandy der Überzeile, der fettgedruckten Einleitung, der halbversteckten Anspielung sowie eines Wortwitzes aus zweiter Hand gereift, der die seltene Fähigkeit besaß, das Glück anzuziehen und es vermehren zu können, verwandelte der dick aufgetragene patriotische Anstrich sich wie von allein in klingende Münze.
Erfindungsreich in der Anfertigung seiner geschliffenen Fertigfabrikate, Vorspanne, Abspanne sowie all jener standardisierten Stellen, die, im Bewusstsein der Wiederholbarkeit, bestimmten Stanzmustern glichen, um sogar noch die gedankenlosesten Abonnenten sofort einen "echten >Ari Papp< beziehungsweise >Arp< erkennen zu lassen, setzte er, jeder Zoll ein in seinem Stilempfinden bestärkter Aufsteiger, dem aus harten Anfängen der Durchbruch geglückt war, seine produktive Schreibpraxis ausdauernd und konsequent fort. Nagender existentieller Sorgen längstens enthoben und zumeist erst um drei, vier Uhr morgens vom Theater, aus den Kaffeehäusern oder sonstigen Lustbarkeiten heimkehrend, blieb Papp, immerfort auf dem Sprung, auch im schönen Budapest, dem Sitz seiner Redaktion, eine Person mit wenig festen Momenten.
Читать дальше