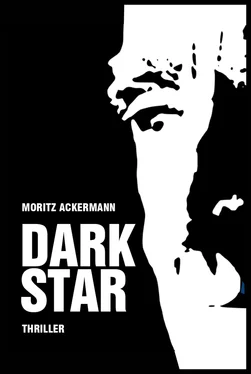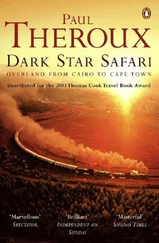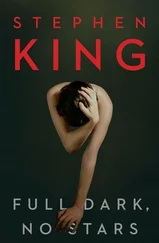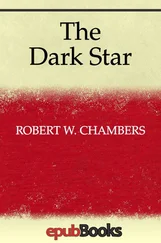Marcelo Figueroa und der Touristenführer, Jesús Rivero, hingegen waren das Drogenduo der Stadt. Die beiden hatten eine ganze Gefolgschaft, mit der sie zum Base-Rauchen und Zuckerrohrschnaps-Saufen irgendwo in die Natur fuhren. Das Ganze nannte sich ›Angler-Club‹. Die fuhren dann nächtens raus an irgendwelche Seen und föhnten sich dort das Hirn raus, geangelt wurde nie. Das Rausfahren hatte mit dem starken Gestank der Base beim Rauchen zu tun, ein Vorprodukt der Kokainherstellung - im Dorf wäre der Geruch sicher aufgefallen.
Oft fuhr ich mit Juán auch einfach nur durch die Peripherie von San Ignacio. Die Stadt war im kolonialen Schachbrettmuster angelegt. Sie wuchs sehr schnell, wie ein runder Tintenklecks, der sich im Löschpapier ausbreitet. Ihre Straßen waren alle rechtwinklig angeordnet, aber ihre Form war rund. Und so gab es in der Peripherie auch eine Umgehungsstraße, einen City-Ring, wenn man so will. Alles aus roter Erde, versteht sich.
Wir fuhren viel zusammen rum, denn zu tun gab es wenig, aber man musste immer aktiv erscheinen. Da machte sich das Herumfahren auf dem Motorrad immer gut, denn man hatte offensichtlich ein Ziel, wenn es auch nur so schien. Tatsächlich fuhren wir oft einfach nur irgendwohin, um ungestört abzuhängen. Wir hatten immer ein paar Dosen Bier dabei. Gerne gingen wir zur nördlichen Seite des Stausees, der sich am Fuße des leicht abschüssig gelegenen San Ignacio befand. Dort war eine große Christusstatue mit einem Altar darunter. Der Ort war nur nachts bevölkert, vor allem von Jugendlichen, die dort Sauf-Partys veranstalteten. Manchmal fand ein Kleinwagen-Fick statt. Nachmittags fuhren wir oft dorthin und schauten dem Sonnenuntergang zu, der fast jeden Abend spektakulär war.
Ein anderes unserer Ziele auf dem City-Ring war der neue Schlachthof, der jenseits des Sees auf seiner nördlichen Seite von brasilianischen Investoren auf der grünen Wiese gebaut worden war. Finanziert natürlich mit Geld aus dem Drogenhandel, das die Brasilianer dort, kurz hinter ihrer Grenze, lukrativ und ohne lästige Kontrollen waschen konnten. Mir fiel sofort Tomás Echeverría ein mit seinen Erzählungen von den riesigen Latifundien, welche die Brüder von jenseits der Grenze im Munizip San Ignacio bereits erworben hatten. Der Schlachthof war modern gestaltet, mit Ruhezonen für die Rinder, die sollten sich sogar per Schnauzendruck duschen können, bevor ihnen die letzte Stunde schlug. Alles deutete auf den technisch neuesten Stand hin, wie die Brasilianer es gerne hatten: vollautomatisiert, mit rostfreier Stahlinstallation und Computersteuerung, wie sie es mir und Juán eines Tages stolz vorführten. Sie hatten bereits riesige Sickergruben für die Schlachtabfälle eingerichtet. Was allerdings bedenklich war: Der felsige Untergrund unterhalb des Schlachthofes war zum Stausee hin geneigt. In ein paar Jahren würde das Sickerwasser der Schlachtabfälle in den See gelangen und dann würde San Ignacio auch sein hausgemachtes Trinkwasserproblem haben.
Die Stadt lag auf der südlichen Seite des Stausees auf ebenfalls leicht geneigtem Terrain. Der See selber sah gar nicht so sehr aus wie ein Stausee. Außer dem Damm, über den ein Teil des City-Rings führte, deutete fast nichts auf seine Eigenschaft als Stausee hin, die Ufer wirkten natürlich. Nur zu seinem fernen östlichen Ende hin ragten noch viele alte Baumstrünke aus dem dort seichter werdenden Wasser. Das gesamte abgelegene östliche Ufer mäanderte in einem riesige Schilfmeer aus. Dort lebten noch Kaimane und Anakondas.
An der Stelle, wo das Ufer des Sees an städtisches Gebiet grenzte, gab es sogar Sandstrände. Dort planschte die indianische Bevölkerung, niemand schwamm. Die Leute vom Munizip meinten aber, dass es nicht so gut wäre, wenn die da immer badeten, weil ja dann die Säfte der ganzen ungewaschenen Mösen, Schwänze und Ärsche ins Trinkwasser kämen. Das Gegenargument, dass nämlich am Dammende eine Kläranlage für relativ sauberes Wasser sorgte, war den meisten kaum zugänglich - der Gedanke an auch nur molekülartig vorhandene Genitalresiduen der Indianer im Trinkwasser machte die weiße Elite nervös.
Boote gab es auf den ersten Blick gar keine. Dabei war der Stausee gut zum Segeln geeignet, von seiner Größe und auch von den Winden her. Juán meinte, die Leute hätten Angst, weil niemand schwimmen könne und Boote ja untergehen könnten. Später fand ich mit ihm eine einsam gelegene Fischerhütte zum östlichen, schilfigen Ende hin, wo ein alter Indianer mehrere kleine Einbäume hatte. Die waren allerdings recht wacklig und definitiv für Leute geringer Größe und Gewichts gemacht. Die Reling seiner Boote war so knapp über dem Wasserspiegel, dass ich mich da nicht hineingesetzt hätte. Der alte Mann aber manövrierte mit ruhiger Geschicklichkeit sein Boot und brachte immer guten Fisch heim. Im besten Falle Pirañas, im Schlechteren kleinere, hechtartige Fische. Die kaufte ich oft morgens bei ihm. Die Pirañas waren gut, umso größer desto besser, am liebsten gebraten, da konnte man die knusprigen Flossen mitessen.
Die Pirañas waren auch der eigentliche Grund dafür, dass niemand schwamm. Erst lachte ich darüber, aber dem Kollegen Markus Treffer hatten die kleinen Teufel ganze Stücke Fleisch aus dem Oberschenkel gerissen. Er war bei dem Angriff nur zehn Meter weit rausgeschwommen und dann gerade noch so an die Uferzone gekommen, weil diese Viecher bei Blutgeruch in Schwärmen angreifen. Die Narbe war daumengroß und hässlich, in Schwanz- und Arterien-Nähe. Klar, dass da keiner schwimmen wollte. Die kleinen Monster hatten so eine Art ausfahrbares, zweites Gebiss im Maul, so wie das Monster aus Alien.
Direkt am zentralen Platz der Stadt lag der Bischofspalast mit seiner dazugehörigen Kirche. Er nahm die ganze nördliche, also seeseitige Stirn des Platzes ein und war einen Häuserblock groß. Säulengänge und jesuitische Fresken zierten den Komplex. Von dort zum See hin waren es noch mehrere Planquadrate, die alle der Diözese gehörten, bis zu einem Seegrundstück. Die Planquadrate waren zur Seeseite des Palastes hin spärlich bebaut und in erster Linie noch Weideland oder einfach mit hohem Schilfgras bewachsen, staubige Wege markierten die unbebauten Parzellen. Erst viel weiter östlich, auf einer Halbinsel, war das Seegrundstück wieder bebaut, es war von einer weit in den See reichenden Ziegelmauer umgeben, so dass man hätte schwimmen müssen, um seeseitig hineinzugelangen. Die Mauer war etwa drei Meter hoch und mit eingemörtelten Glassplittern gekrönt. Sie war in schlechtem Zustand, aber an keiner Stelle passierbar. Es gab ein großes Tor und eine kleine Tür daneben. Das große Tor war zugemauert, die kleine Tür war aus Massivholz, das kaum verwitterte. Das schwere Vorhängeschloss war voller Spinnweben. Wenn man sich in einigem Abstand auf eine kleine Anhöhe stellte, zu der man sich den Weg durchs Dickicht mit einer Machete bahnen musste, konnte man zwischen den riesigen Mangobäumen, die das Grundstück dominierten, eine große Villa im italienischen Stil mit Säulenvorbau und Eingangstreppe erahnen. Ansonsten war das Anwesen von keiner Seite einsehbar. Das alles hatte ich bereits zuvor ausgekundschaftet.
»Kann man das besichtigen? Wem gehört das?« fragte ich Juán, als ich ihn eines Tages überredet hatte, dorthin zu fahren.
»Gehört der Diözese. Oder dem Bischof. Der hat das vor dreißig Jahren von einem Deutschen gekauft, der da wohnte. Aber gemacht wurde da nie was. Da ist nicht mal ein Aufpasser.« Wir hatten uns gerade durchs Dickicht auf den kleinen Hügel hochgekämpft und standen schwitzend in der schwülen Hitze des Schilfgrases, das uns umgab. Mücken und Fliegen machten uns zu schaffen, in Abständen zog Aasgeruch vorbei.
»Man könnte da reinschwimmen, um die Mauer rum.«
»Und dann? Da geht keiner rein, nicht mal der Bischof und das will was heißen. Das ist kein guter Ort, keiner traut sich da rein.«
Читать дальше