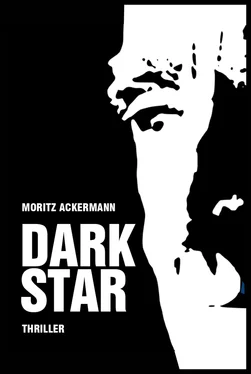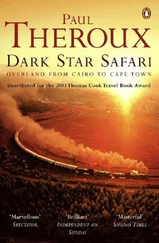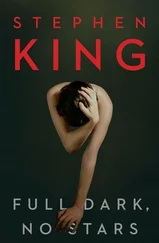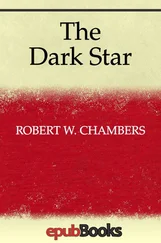Mit Markus Treffer, dem Kollegen aus dem Schwarzwald, der den Indianern bei ihrer Holzwirtschaft helfen sollte, war es ähnlich, nur war er insistenter und legte sich dauernd mit den Caciques der Comunidades an, die ihr Holz heimlich billig verscheuerten. Das fand ich mutig und richtig. Er versuchte ernsthaft, den ganzen Betrug zu unterbinden, suchte nach Lösungen gegen den illegalen Holzverkauf. Er verhandelte mit der bolivianischen Elektrizätskooperative, um das Hartholz für die Strommasten bestmöglich zu verkaufen. Es kam kein Geschäft zustande. Keiner hatte Interesse daran, dass die Indianer wirklich vorankamen, sie kauften lieber illegal geholzte Stämme für billiges Geld. Und die Indianer selbst hatten auch kein wirklich kommerzielles Interesse, was ich gar nicht so schlecht fand, sie lebten eh sehr viel mehr im Gleichgewicht mit ihrer Umwelt als wir oder die Kreolen, die wir aus einer verrückten Konsumwelt kommen.
Häufig diskutierten wir diese Themen an den vielen gemeinsamen Abenden in der Casa de los Cooperantes. Und immer lief es darauf raus, dass man ja eigentlich nichts machen könne, die Hände seien ja gebunden, es waren die Auflagen, man dürfe sich politisch nicht engagieren.
Meine Tagesabläufe in jenen ersten Monaten waren immer gleich. Ich wachte morgens so um sechs Uhr auf, machte zwei Stunden Hardcore-Sudokus im Bett, um dann aufzustehen.
Ich schaute jeden Tag im Munizip vorbei und alle paar Tage bat ich um eine Audienz bei Erwin Mendez. Es war immer nett mit ihm, aber es kam nie was dabei heraus.
Am späten Vormittag ging ich eine Teigtasche bei Doña Pabla essen, einer alten Hexe, die aber Essen zubereitete, das mir keinen Schaden zufügte.
Um die Mittagszeit ging ich wieder nach Hause, nie ohne auf dem Weg ein kleines Bier im Laden zu kaufen. Man muss dazu sagen, dass in der Jahreszeit, in der ich angekommen war, auf der südlichen Hemisphäre Winter herrscht. Furztrocken und irre heiß. 40°C morgens um zehn waren keine Seltenheit. Das ging nicht ohne kaltes Bier. Nur manchmal, so alle zwei bis drei Wochen, kamen eiskalte Südwinde aus dem winterlichen Argentinien und aus Paraguay. Wenn die tagsüber hereinbliesen, konnte man beobachten, wie die Temperatur innerhalb von einer Stunde von 40°C auf 10°C abfiel, immer von starken, kalten Winden begleitet. San Ignacio war dann menschenleer und triste. Die Wolkendecke hing tief, zum Anfassen nahe. Immer nieselte es. Ich legte mich dann ins Bett und las den ganzen Tag oder schaute schwachsinnige Hollywood-Produktionen auf dem Laptop an. Nach ein paar Tagen war es dann vorbei und alles ging wieder seinen gewohnten Gang.
Die Nachmittage waren meist noch entspannter als der Vormittag. Ich hing manchmal im Munizip rum und blödelte mit den Angestellten oder fuhr einfach mit dem Auto rum und versuchte, den kleinen, verborgenen Zauber zu finden, den keiner der Ortsansässigen wahrnahm: Häuserruinen in der Peripherie, antike Autowracks, überwuchert mit Schlingpflanzen, Kinder der Ärmsten, die mit leeren Joghurtflaschen Puppenfamilie spielten und ähnliche in der Regel unbeachtete Phänomene.
Oft, wenn ich am späten Nachmittag nach Hause lief, kam ich an der Musikschule vorbei, die vom Bischof gesponsort wurde. Das einzig wirklich Sinnvolle, was der Idiot vollbrachte. Die Kurse waren nach Altersklassen zusammengefasst. In jedem der zahlreichen Klassenzimmer befand sich jeweils ein komplettes Kammerorchester, in der Regel mit Gesangsstimmen, ausgewählte Mädchen mit wunderschöner Altstimme. Sie spielten in erster Linie Barockmusik aus Deutschland, aber auch lokale Kompositionen der Jesuiten. Die Klasse der Fortgeschrittenen übte seit längerer Zeit Klassik ein, das C-Dur-Streichquintett von Schubert. Es holperte allerdings noch erheblich.
Langsam verstand ich auch die sozio-politische Lage im Land besser. Die Hochlandindianer, deren größte ethnische Untergruppe die Quechua- und Aymara-Indianer bildeten, hatten durch die Präsidentschaft von Evo Morales erheblichen Machtgewinn zu verbuchen, was ja auch angesichts ihrer totalen Unterdrückung in den vergangenen fünfhundert Jahren irgendwie an der Zeit war. Sie waren die Collas, abgeleitet vom Collasuyo, dem südlichen Inkareich unter Hauscar Capac, dem letzten Inkaführer des Südens bei Ankunft der spanischen Conquista. Dieser hatte sich einen jahrelangen Krieg mit seinem Halbbruder Atahualpa geliefert, letzterer herrschte über das nördliche Inkareich Tauantinsuyo, das in etwa dem heutigen Ecuador und Kolumbien entspricht.
Als dann erhebliche Teile der zivilen und waffenfähigen Bevölkerung in beiden Reichen im Bruderkrieg gefallen waren, gab es Friedensgespräche. Beim ersten Gespräch nutzte Atahualpa die Gunst der Stunde, nahm seinen Halbbruder gefangen und war damit, termingerecht zur Ankunft der Spanier, Alleinherrscher im gesamten Inkareich geworden, das zu jener Zeit riesig war und von Feuerland bis Panama das ganze andine Rückgrat des Kontinents umfasste.
Allerdings gab es kaum noch Krieger, die den Spaniern hätten Widerstand leisten können. Und so ging alles dann ganz schnell, Atahualpa wurde schließlich vom goldgeilen Pizarro, einem Schweinehirten aus der spanischen Estremadura, ermordet. Danach folgten Jahrhunderte unangenehmer Leibeigenschaft für die Collas unter spanischer Knute. Das änderte sich auch nicht mit der Befreiung von den Spaniern 1825. Die weißen Siedler und Minenbesitzer machten da weiter, wo die Spanier aufgehört hatten: Ausbeutung von Land und Leuten. Damals war das gesamte Tiefland Boliviens kaum erschlossen, die Musik spielte im Hochland, wo die Bodenschätze lagen.
Erst in den 1950er Jahren änderte sich das mit dem massiven ökonomischen Aufstieg von Santa Cruz. Das Tiefland, bislang nur ein kleiner Agrarproduzent, entwickelte sich unter den Kreolen, den weißen Eliten, zu einem agrarischen und industriellen Schwerpunkt, der sich mehr an den Nachbarländern Argentinien, Paraguay und Brasilien orientierte denn am logistisch nur schwer zu erreichenden eigenen Hochland. Dies aber in erster Linie im weiteren Umkreis von Santa Cruz. Der Osten, also die weitere Umgebung von San Ignacio, blieb verschlafen. Die erstarkenden Lowländer nannten sich Cambas. Ebenso wie der Terminus Colla für die Highländer, bezieht sich Camba auf beide Teile der Bevölkerung: Indianer und Weiße.
Die Gegenden im östlichen Tiefland, die Gegend, in der San Ignacio lag, wurde im siebzehnten Jahrhundert von mutigen Jesuiten kolonisiert. Die Jesuiten brachten Frieden unter die kriegerischen Indianerstämme, gründeten Städte, sogenannte Jesuiten-Reduktionen, etablierten einen eigenen klerikalen Kunststil und lehrten die Indianer das Instrumentespielen und das Komponieren von Barockmusik. In der Endphase der spanischen Herrschaft wurden die Jesuiten dann allerdings vom spanischen König wieder wegbeordert, sie waren im tiefen Kern des Kontinents auf wirtschaftlicher Ebene einfach zu mächtig geworden. Neben dem östlichen Tiefland von Bolivien hatten sie auch Teile von Paraguay und Brasilien bekehrt.
Aus der Zeit der Jesuiten stammen die ganzen Namensgebungen der Städte in der Chiquitania, dem östlichen Tiefland … Santa Rosa, San Miguel, Concepción, San Javier, San Ignacio, San Teodoro und so weiter.
Im Zuge der Befreiung seiner Stammesgenossen betrieb der Präsident Evo Morales Ayma eine Art Lebensraumpolitik für die Collas. Die Bodenschätze waren versiegt, das karge Hochland war landwirtschaftlich kaum zu bearbeiten, das östliche Tiefland hingegen, mit scheinbar endloser Landfläche, bot für die seit jeher fleißigen und arbeitsamen Collas ideale Anbaubedingungen. Die Collas kamen in LKW-Ladungen an, blieben und bauten erfolgreich an. Die Bräuche brachten sie aus dem Hochland mit, zum Beispiel ihre dicke Kleidung, die sie auch in der Hitze des Tieflandes nicht aufgaben. Die Frauen hatten stets mehrere Röcke übereinander an und so dürfte – vergegenwärtigt man sich ihre äußerst spärliche Körperhygiene, die sie aus dem kalten Hochland mitgebracht hatten – bei 40°C unter jenen Kleidungsstücken eine knockende Atmosphäre herrschen.
Читать дальше