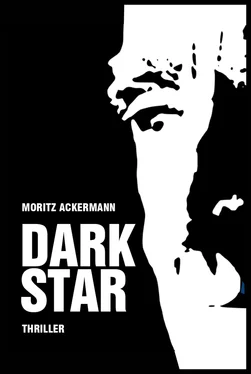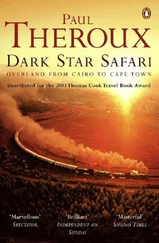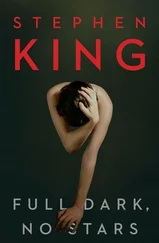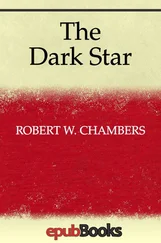»Darf ich dich fragen, wie alt du bist?«
»Klar, ich bin fünfunddreißig, warum?« Sie wirkte irritiert, ihre Antwort war kurz.
»Warum nicht?« Ich lachte verlegen. Ich wollte mir nicht vorstellen, dass die Frage sie irritierte. Frauen soll man nicht nach dem Alter fragen, aber sie wirkte locker, also warum nicht? Aber sie schwieg und fragte mich nicht nach meinem.
Wir waren bereits zwei Stunden schweigsam durch endloses Agrarflachland gefahren, als die Gegend langsam bewaldeter und das Terrain hügeliger wurde. Die Landschaft erinnerte an die afrikanische Steppe, besonders an Abschnitten, auf denen sich große Viehweiden auftaten und auf denen vereinzelte, riesige, ausladende Bäume standen, die in ganz wunderbaren Farben blühten. Einzelne Bäume standen derart in rotorangefarbener Blüte, dass man hätte meinen können, sie stünden in Flammen.
»Du hast mir noch kein einziges Mal auf den Busen geschaut.« sagte sie plötzlich unvermittelt auf Französisch.
»Woher weißt du, dass ich französisch spreche?« Ich sprach weiter Deutsch mit ihr.
»Die meisten Männer starren mir immer auf den Busen, du nicht.«
»Genau deswegen wollte ich es nicht tun.« Sie lächelte mich kurz an und schaute dann gedankenverloren aus dem Seitenfenster. Sie lehnte sich dabei auf die Armstütze der Beifahrertür und schaute auf die vorbeiziehende Natur.
Wir erreichten eine Tankstelle und hielten kurz an. Ich tankte, kaufte eine Tüte Kartoffelchips und vier Dosen kaltes Bier. Wieder im Auto, bot ich ihr ein Bier an, sie nahm es und wir stießen an.
Nach einer Weile erreichten wir San Javier, eine der ersten von Jesuiten vor Jahrhunderten gegründeten Städte. Die Durchfahrtstraße war eng und voller Schlaglöcher. Bis zu jenem Moment war der Asphalt in keinem allzu schlechten Zustand gewesen, nun wurde es einigermaßen schwierig voranzukommen. Zwar gab es Abschnitte mit geschlossener Asphaltdecke, doch immer wieder kamen Überraschungen in Form von Schlaglochteppichen, in die man dann polternd hineinrauschte. Die Landschaft wurde jetzt immer hügeliger und war, wo sich der Wald öffnete und das Grasland freigab, mit großen, graurosafarbenen Findlingen übersät, die wie riesige Säcke aussahen. Hier bestand die Viehwirtschaft offensichtlich aus der Zucht von Wasserbüffeln, die sich auf den Weiden und in den zahlreichen Tümpeln tummelten.
»Ich habe im Internet deinen Namen gegoogelt. Auf deinem Profil bei der Universität Ulm steht, dass du etliche Jahre in Paris verbracht hast.« Ich hatte in Ulm vor Jahren versucht, zu promovieren. Die hatten vergessen, nach meiner gescheiterten Doktorarbeit mein Profil da rauszunehmen. Sie redete weiter auf Französisch.
»Warum ziehst du es vor, Französisch mit mir zu reden? Ich meine, du sprichst sehr gut Deutsch.«
»Ich fühle mich wohler, keine Ahnung. Das hat mit dir zu tun, ich spreche gerne Deutsch. Ich fühle mich aber so mehr ich selber, wenn ich mit dir rede.«
Mich überraschte ihre veränderte Art. Sie war jetzt eine andere Person als die, die ich beim Abendessen mit Tomás kennengelernt hatte. Ich war verunsichert durch ihre neue Ernsthaftigkeit. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich mochte.
Nach einer weiteren Stunde erreichten wir Concepción. Es war siebzehn Uhr und es dämmerte. Ich schlug vor, dort zu übernachten, da es bereits spät war und wir bei Tageslicht nicht mehr in San Ignacio ankommen würden. Zudem endete in Concepción die Asphaltstraße, und die kommenden zweihundert Kilometer würden nur Comunidades – autochtone Indianergemeinschaften - die Straße säumen. Handynetz oder Telefonleitungen gab es dort nicht.
Odile war einverstanden, und wir suchten uns ein kleines Hotel am zentralen Platz, an dem eine dieser riesigen jesuitischen Barockkirchen stand. Der Kern der Stadt war immer noch so angelegt, wie die Jesuiten dies zu ihrer Zeit entworfen hatten. Die Häuserblocks waren zur Straße hin gesäumt von einem einzigen durchgehenden, einstöckigen Gebäude, das im Wohnungsabstand Einfahrten und Hauseingänge aufwies, es hatte etwas Kasernenartiges. Es gab keine Bürgersteige, dafür die bereits aus Santa Cruz bekannten Säulengänge vor den Häusern. Auf den staubigen Straßen aus roter Erde spielten Kinder. Wir betraten einen solchen Eingang, der uns in den Innenhof des Hotels ›Lupita‹ führte. Dieser war, ähnlich dem der Casona in Santa Cruz, mit viel Grün und indianischem Folkloretand ausgestattet. Auf einer Stange saß ein Tucán mit gestutzten Flügeln.
Da ich das Auto im Patio des Hotels parken durfte, nahmen wir nur unser Handgepäck aus dem Auto. Wir nahmen zwei Einzelzimmer, was denn sonst. Wir verabredeten uns fürs Abendessen zwei Stunden später, sie wollte sich vorher noch frisch machen und ausruhen.
Das Zimmer war einfach, ohne Klimaanlage, so dass es zu dieser Tageszeit immer noch sehr heiß war. Ich öffnete die Fenster, da es draußen bereits kühler wurde. Die notwendigen Moskitonetze bremsten den Luftaustausch aber erheblich. Ich legte mich aufs Bett und schaltete den Fernseher ein, es gab aber nur zwei Lokalprogramme. Ich schaltete ihn wieder aus. Schließlich schlief ich ein und träumte Seltsames. Ich wachte um 19.30 Uhr auf, Odile pochte an meine Tür. Ich sprang in die Jeans und öffnete im Unterhemd. Sie kam einfach rein und setzte sich aufs Bett.
»Ich habe auch verpennt. Als ich dich nicht fand, habe ich nach deinem Zimmer gefragt.« Sie hatte sich offensichtlich entschieden, das Französische mir gegenüber nicht mehr abzulegen.
»Tut mir leid, ich dachte nicht, dass ich überhaupt einschlafen würde. Konntest du ausruhen?« Ich dachte kurz daran, auch ins Französische zu wechseln, aber das Spiel mit den zwei Sprachen gefiel mir und außerdem war ich im Moment eh mehr ans Spanischsprechen gewöhnt.
»Ich habe ganz komische Sachen geträumt. Wollen wir was essen gehen?«
»Gern.« Ich zog ein weißes Hemd aus der Reisetasche und warf es über. Ich spürte ihren Blick, als ich es tat. Ich zog die Rumflasche aus dem Rucksack und nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche, was sie zum Lachen brachte. Ich bot ihr die Flasche an, sie lehnte aber ab. An der Rezeption nannte uns Doña Lupita ein gutes Restaurant direkt am Platz. Es lag nur fünfzig Meter vom Hotel entfernt und war ebenfalls in dem Patio eines der kasernenartigen Langhäuser untergebracht. Der Patio war noch typischer als der des Hotels und der Duft aus der Küche versprach gutes Essen. Wir setzten uns an einen Zweiertisch, die Bedienung brachte die Karte. Es gab Fleisch und Fisch, wir bestellten beide gegrillten Piraña und argentinischen Weißwein.
Beim Essen redeten wir zunächst recht belanglos über Santa Cruz. Ich fragte sie nach ihren Erfahrungen im Hochland. Sie erzählte von einer Reise an den Salzsee Uyuni und von der Schönheit Sucres, sie mochte die Landschaften des Hochlandes, konnte aber das Klima nur schwer ertragen, ein Eindruck, den ich teilte. Sie erzählte mir von ihrem Leben in Kanada und warum sie Frankreich vorzog. Ihr Vater war Algerier und ihre Mutter Französin, beide hatten zur Zeit ihrer Geburt als Ärzte in Quebéc gearbeitet. Sie hatte dementsprechend neben der französischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft.
Der Fisch war grätenreich, aber sehr lecker, sogar die Salatportion war erkennbar vorhanden. Wir zahlten und verließen das Restaurant, beschlossen aber, noch ein bisschen Concepción zu erkunden.
Viel gab es im Dunkeln nicht zu sehen, aber die Stadt war ganz nett. Dort, wo die koloniale Bauweise aufhörte, ging die Besiedlung in strohbedeckte Hütten über. Sie befanden sich auf weitläufigen Grundstücken, vor den Häusern hingen Gruppen von Hängematten, in denen die Bewohner lagen oder saßen und miteinander plauschten. Der Erdboden um die Häuser herum war gefegt und völlig ohne Grasbewuchs. In Abständen standen am Rand oder innerhalb der viereckigen Häuserblocks riesige Mangobäume, deren kräftige Äste im unteren Baumbereich weit horizontal zur Seite wuchsen. Die mussten in der Mittagshitze kühlen Schatten spenden, dachte ich mir.
Читать дальше