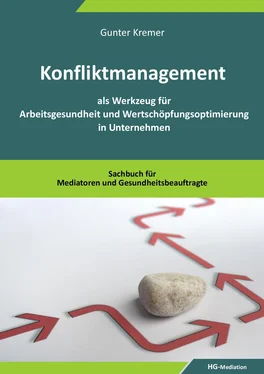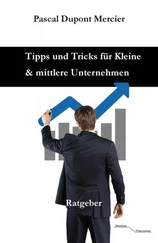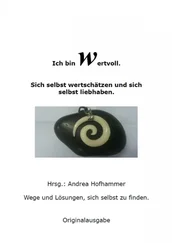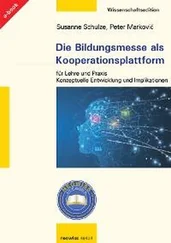Die Ziele einer Wirtschaftsmediation richten sich nach den Wünschen der Parteien, die zu Beginn des Verfahrens zu klären sind. Im Hinblick auf die Lösungsoffenheit dürfen jedoch für den Ausgang der Mediation keine konkreten Vorgaben (beispielsweise seitens der Unternehmensleitung und/oder Personalverantwortlichen) gemacht werden.
2.2.3 Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft (RTMKM)
Als zentrales Forum der deutschen Wirtschaft zum Thema Mediation und Konfliktmanagement bietet der „Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“ (RTMKM) nicht nur eine Plattform für einen offenen und kooperativen Austausch zwischen den beteiligten Unternehmen, sondern bildet eine Schnittstelle zur Konfliktwissenschaft und zur Politik. 30Als Grundlage für eine gemeinsame Arbeitssprache definieren die Autoren die Begriffe Konflikt, Konfliktmanagement, Konfliktprävention, außergerichtlicher Konfliktbearbeitung, Konfliktprävention und Mediation. 31Trotz kleiner Formulierungsunterschiede gleichen diese Beschreibungen den bisher gemachten, so dass auf ihre Inhalte nur verwiesen wird. Zum Bereich Wirtschaftsmediation empfehlen die Autoren eine Unterscheidung von drei Konfliktkategorien, hinsichtlich unterschiedlicher Charakteristika und Herausforderungen – mit Verweis auf Zühlsdorf 32– als: 33
„Konflikte am Arbeitsplatz“
„Konflikte zwischen Unternehmenseinheiten/Konzerngesellschaften“
„Konflikte zwischen Unternehmen“.
2.3 Konfliktmanagementsysteme
Gemäß der Definition von Gläßer et al. ist Konfliktmanagement der „systematische und institutionalisierte Umgang mit Konflikten, wobei die einzelnen im Unternehmen existierenden Elemente unterschiedliche Funktionen erfüllen“. Im Rahmen der zitierten Studie wird ein Komponenten-Modell erarbeitet, welches eine Kategorisierung und Zuordnung der einzelnen Elemente entsprechend ihren Funktionen ermöglicht. Dieses besteht aus: 34
„Konfliktanlaufstellen
Systematik der Verfahrenswahl
Konfliktbearbeiter
Verfahrensstandards
Dokumentation/Controlling/Qualitätssicherung
Innen- und Außendarstellung/Kommunikation.“
Mit dieser Kategorienbildung sei es nach den Autoren möglich, aus den unterschiedlichen Komponenten einzelne Elemente (als Optionen in einem Spektrum von Alternativen) so auszuwählen und zusammenzufügen, dass ein vollständiges und für die jeweilige Bedarfslage eines Unternehmens maßgeschneidertes Konfliktmanagement-System entstehe. Die Komponenten kategorisieren Konfliktmanagement-Maßnahmen und sind nach dem Verständnis der Autoren unabhängig von der Konfliktkonstellation – sie sind also grundsätzlich für alle Unternehmenskonflikte verwendbar. Ein Konfliktmanagement-System liegt nach dem Verständnis der Autoren allerdings erst dann vor, wenn: 35
„alle sechs aufgeführten Komponenten durch entsprechende Elemente realisiert werden und
eine Steuerungsinstanz als siebte Komponente hinzutritt, welche die einzelnen Elemente systematisch vernetzt und ihr funktionales Zusammenspiel regelt.“
Das Erfordernis einer Steuerungsinstanz ergebe sich aus der klassischen Managementlehre (mit Verweis auf die Ergebnisse der qualitativen Folgestudie 36), deren Grundsätze auch auf KMS anzuwenden seien.

Abbildung 3: Das Viadrina-Komponentenmodell eines Konfliktmanagement-Systems 37
Koweit et al. werten die Etablierung eines KMS als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und heben insbesondere die Chance zur Reduktion der Konfliktkosten hervor. 38Kirchoff et al. schlagen deshalb folgerichtig die Integration von KMS in das strategische Risikomanagement (RM) vor. 39Dieses hat als Ziel die Sicherung der Unternehmensziele und damit des Unternehmenserfolges, im Hinblick auf die Vermeidung unnötiger Kosten. ( Konfliktkosten gelten als Risikokosten).
Kloweit et al. sehen (bezugnehmend auf die Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft) KMS auch als wertvollen Beitrag für ein ganzheitliches Changemanagement (CM), im Sinne der Förderung einer nachhaltigen und konstruktiven Unternehmens- und Führungskultur. Schließlich weisen sie auf einen zu erwartenden positiven Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungserbringung hin. 40
Schließlich ergänzend bedeutet Konfliktprävention im Verständnis von Gläßer et al. die gezielte Verhinderung der Entstehung von Konflikten, bzw. einer destruktiven Austragung oder Eskalation von Konflikten. 41Nach Herrmann kann es zu derartigen Eskalationen infolge nicht tragfähiger Konfliktlösungen kommen, welche nicht nur im Ergebnis für die Beteiligten von Bedeutung sind, sondern auch hinsichtlich ihrer künftigen Wahrnehmung von Konfliktsituationen. Der Autor begründet daraus die negative Belegung des Konfliktbegriffes in der allgemeinen Wahrnehmung. 42

Abbildung 4: Inadäquate Konfliktlösung und ihre Folgen 43
2.4 Fokusbegrenzungen
Hinsichtlich der Vielfalt der Unternehmensformen und der damit verbundenen Komplexität konzentrieren sich die Betrachtungen in dieser Arbeit auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU), im Speziellen Vertreter des produzierenden Gewerbes (Metall- und Elektrobranche). Gemäß § 267 Handelsgesetzbuch HGB 44werden kleine Unternehmen als solche mit bis zu 49 Mitarbeitern verstanden, mittlere Unternehmen sind solche mit 50 bis 249. Die KMU haben eine große wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland; sie erwirtschaften rund 40% aller Umsätze; bei ihnen arbeiten über 60% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. 45
Neben Gründen einer Umfangsbeschränkung und einer persönlichen Relevanz spielt der Umstand eine Rolle, dass Großkonzerne eher die Bereitschaft zu zeigen scheinen, ihre Strukturen hinsichtlich eines Konfliktmanagementsystems umzugestalten. Diese Annahme begründet sich u.a. aus der Art der teilnehmenden Unternehmen am RTMKM. In KMU bestehen nur teilweise eigene Personal- oder Rechtsabteilungen, welche klassischerweise mit internen bzw. externen Konflikten zu tun haben und als „Inkubatoren“ bzw. „Promotoren“ bei der Einführung von KMS dienen könnten. Weiterhin besteht die Grundannahme, dass es in KMU weniger definierte Arbeitsabläufe und gefestigte Strukturen gibt, an welche ein KMS „angedockt“ werden kann. Konflikte werden häufig fallabhängig und situationsbezogen entschieden, unter einem hohen Belastungsgrad der beteiligten Mitarbeiter. Diese zufällige Vorgehensweise entspricht nicht dem Prozessgedanken (eines Managementsystems) und bildet zudem den Nährboden für Folgekonflikte, ohne Möglichkeit der systematischen Regelung. KMU sind auch in einem besonderen Maße von der Haltung der Unternehmensführung (und der dabei entstandenen Konfliktkultur) abhängig, sowie dessen Bereitschaft, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ziel der kommenden Überlegungen wird deshalb sein, wie unter diesen Umständen ein Zugang zu den Unternehmen gelingen kann.
2.5 Zur bisherigen Anwendungspraxis von Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement
Читать дальше