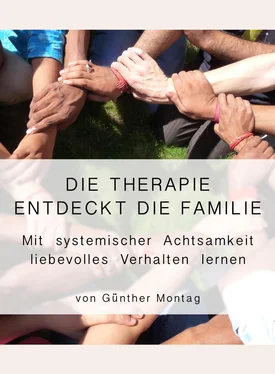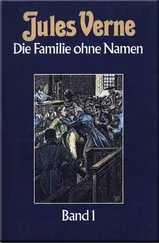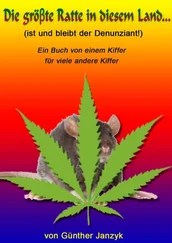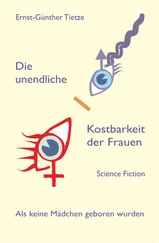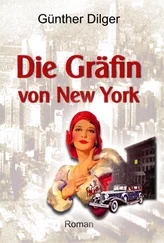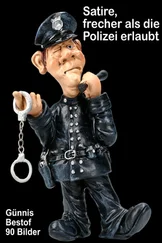Die Überlebensstrategie - die Absicht des Funktionierens
Diese wichtige Grundannahme der VT ist sehr praktisch, und ist beeinflusst von der Evolutionstheorie: Die Grundabsicht eines Wesens sei das Funktionieren, um zu überleben. Der Mensch, wie auch das Tier, hat Verhaltensweisen als Kind gelernt, die ihm das Überleben sichern. Zum Beispiel schreit ein Kind, wenn es Hunger hat. Das in dieser Situation sinnvolle Verhalten (schreien) wird belohnt (es bekommt die Mutterbrust). Später kann es sein, dass ein früher gelerntes Verhalten nicht mehr angebracht ist - man spricht dann von „dysfunktionalen Verhaltensweisen“, mit denen wir in der neuen Situation nicht mehr richtig funktionieren.
Zum Beispiel: Das Kind ist im Kindergarten und möchte ein bestimmtes Spielzeug von einem Kameraden haben. Schreien führt nicht zum Erfolg. Wenn es schreit, wird es gemieden (Bestrafung). Das Kind lernt, „bitte“ zu sagen und Zeichen der Höflichkeit und Freundlichkeit zu geben. Vielleicht bekommt es dann das Spielzeug.
Vereinfacht gesagt, funktioniert die VT so: Der Klient kommt mit einem Anliegen. Wir schauen, wie das Verhalten und seine Folgen zusammenhängen. Wir schauen, welches Verhalten er ändern muss und möchte, und überlegen uns Schritte die das leichter machen. Das Ziel ist das „Überleben“ – dass er in seinen Beziehungen bleibt und sie stabilisiert, dass er sich versorgen kann, dass sein emotionales Gleichgewicht ihn trägt und am Leben hält.
So wie uns allgemein in der Schulmedizin gelehrt wird, haben die Götter vor die Therapie die Diagnose gestellt. Was heißt Diagnose auf griechisch? Durchblick. Ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Supervisions-Stunden, als ich meinem Supervisor meine enthusiastischen Heilversuche mit einem Klienten schilderte. Er unterbrach mich mit strengem Blick und fragte ob ich denn außer meiner Liebe auch Therapieziele hätte, und ich solle bitte DREI verhaltensanalytische Sitzungen machen, bevor ich mit der richtigen Therapie beginne. Noch gellen mir diese Worte in den Ohren...
Eine VT beginnt also mit einer Verhaltensanalyse. Darin werden Übertreibungen (Exzesse), was fehlt (Defizite) aber auch Selbsthilfeversuche bezüglich des vom Klienten unerwünschten Verhaltens herausgearbeitet (und im Antrag an die Krankenkasse geschildert, siehe Beispiel unten). Kernstück dieser gedanklichen Arbeit ist eine Aufgliederung des „Teufelskreises“ (der Kausalkette problematischer Verhaltensmuster) in einem hilfreichen Schema, das einem Ablaufdiagramm eines Computerprogramms gleicht – dem SORK- Schema:
S: Situation (Reize, Auslöser)
O: Organismus (Glaubenssätze, Wesenszüge)
R: Reaktion (Verhalten)
K: Konsequenzen (Folgen: negative und positive)
Dazu wird die „aufrechterhaltende Bedingung“ herausgearbeitet, die den Klient hindert, aus dem Kreislauf auszubrechen.
Die selbstlose Krankenschwester
Die abstrakte Theorie erläutere ich am besten nun durch ein Beispiel aus einem Therapieverlängerungs- Antrag, da muss eine solche Verhaltensanalyse enthalten sein. Die Klientin ist eine an einem „burnout“ leidende aufopfernde Krankenschwester.
Bemerkung für Klienten: Keine Angst, die Sachbearbeiter der Krankenkasse lesen solch einen Antrag nicht, sondern er wird anonym in verschlossenem Umschlag an einen weit weg wohnenden Therapeuten geschickt, der ihn begutachtet.)
Verhaltensanalyse:
Exzesse: depressives, selbstanklagendes Grübeln. Jammern, Weinanfälle, Gefühle der Apathie und Leere.
Defizite: Autonome, nicht-leistungsbezogene Aktivitäten, Genießen allein. (Genuss ist nur mit Partner oder Verwandten zusammen möglich.) Behaupten eigener Rechte und Bedürfnisse gegenüber anspruchsvollen Patienten, Verwandtschaft
Qualitativ neues Verhalten: Unsicherheit wegen Überlegungen über Berufsaufgabe und mehr bewusst werdender Spannungen mit Partner
S: (Situation) Rolle einer einsamen Heiligen in der Arbeit. Überfordert sein, Schuldvorwürfe und Spannungen mit Partner.
O: (Organisation der Persönlichkeit) Fachlich patente und kompetente, aber selbstunsichere, zu quälenden Schuldgedanken neigende Krankenschwester, Selbstwertgefühl von Anerkennung, Zuwendung abhängig
R: (Reaktion) Überarbeiten, Selbstvorwürfe bei Erschöpfung, nach Ruhepausen wieder zu schnell wie Stehaufmännchen in die Arbeit rennend. Selbstanklagendes Grübeln. Das Wohlwollen anderer Menschen wird übersehen.
K: (Konsequenzen) Kolleginnen ziehen sich teilweise von überhohen Ansprüchen (an sie selbst, die sie aber auch indirekt an die Kollegen ausstrahlt) zurück, nichts ändert sich.
Aufrechterhaltende Bedingung: selbstabwertende Kognitionen „ich bin unzulänglich, ich bin an allem schuld und für alles verantwortlich“. Erwartungshaltung „niemand ist für mich da, wenn ich Hilfe brauche“.
Selbsthilfeversuche: bisher: Kompetenz in der Arbeit, Zeigen einer fröhlichen, selbstsicheren, lustigen „Maske“ dort.
Verhaltensaktiva: Verantwortungsvolles Ausfüllen des Berufes bisher, auch Kompetenz im Beruf (Pat. bekommt echtgemeintes Lob), Freude an Musik, Posaunenchor, kirchliche Mitarbeit.
Obwohl die Begriffe Reiz und Reaktion leicht vermuten lassen, dass in einer Verhaltensanalyse nur das beobachtbare Verhalten analysiert wird, bezieht eine moderne Verhaltensanalyse auch Gefühle, Gedanken und körperliche Prozesse mit ein, wie das Beispiel zeigt, dazu auch Einflüsse des erweiterten Umfelds des Patienten, wie zum Beispiel das Verhalten von Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten.
Die Verhaltensanalyse kann für die Grundhaltungen und Grundmuster (auf einer Makro- Ebene ) und für Einzelsituationen (auf der Mikro-Ebene) stattfinden. Als Beispiel dafür ist ein Blick auf die Station der Krankenschwester denkbar: Sie hat Kaffeepause, ein Patient klingelt, sie springt in Sekundenschnelle auf, ohne Atem zu holen, anstatt zu delegieren.
Das Beispiel zeigt die VT-übliche Deutung des „burnout“ und der daraus folgenden Depression. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem „Defizit des Lernens“, das heißt, der Klient habe in der Kindheit nicht genügend gelernt, der Verausgabung vorzubeugen, und müsse dies nun nachholen.
Ein ähnliches Deutungsmuster gibt es auch bei Symptomen der Angst – das Augenmerk wird hier auf die nicht genügend gelernte Durchsetzung und Selbstbehauptung gelegt, und entsprechend werden die Übungen der Therapie ausgelegt.
Nach der Verhaltensanalyse einigt man sich mit dem Klienten auf Therapieziele, gliedert den Weg dazu in Schritte und wählt die passenden Übungen dazu. Der Klient muss mitarbeiten – es ist wie bei einem Arbeitsvertrag. Beispiele für Ziele:
Magersucht: Das Gewicht In meinen Gutachteranträgen muss ich konkrete Therapieziele angeben, wie ich das Erreichen überprüfe (z. B wer das magersüchtige Mädchen wiegt), und Konsequenzen bei Erreichen oder Nichterreichen (z. B Klinikeinweisung).
Hypochondrischen Krankheitsängste: Die Zahl der Arztbesuche von 10 auf unter 2 pro Woche reduzieren
Das Erreichen eines Ziels gibt dem Klienten selbst eine positive emotionale Belohnung.
Beispiel für die Therapieplanung unserer Beispielpatientin: (Zitat aus dem Verlängerungsantrag:)
Zielsetzung: Autonomie, soziale Kompetenz! Abkehr vom Leistungs-/Schuldprinzip!
Aktivitäten: Freizeitplanung – Aufbau eigenständiger erfüllender Aktivitäten mit und ohne Partner. Wenn möglich, ermutigen nicht ganz aus dem Beruf zu gehen, da dies auch Kraftquelle.
Kognitiv: Infragestellen der von Kind an sich auferlegten Schuldgefühle. Verantwortlichkeit abgrenzen. Erkennen der unrealistischen Riesen-Ansprüche an sich als „perfekte Krankenschwester“.
Читать дальше