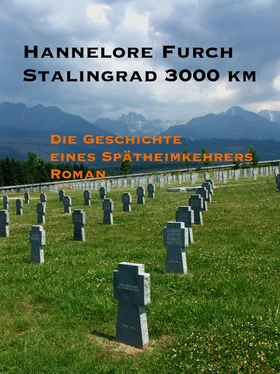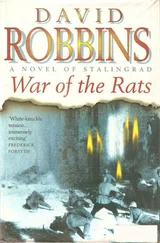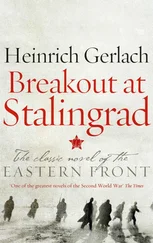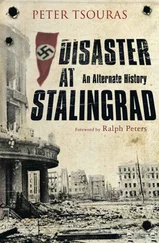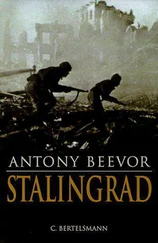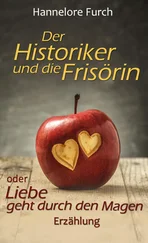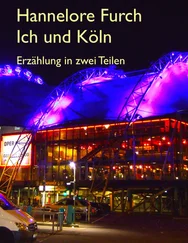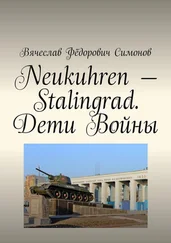Ella! Wie sie die Jahre zuvor nie von Hermann geredet hatte, so kam ihr nach seiner Heimkehr niemals in den Sinn, ihn nach seinen Kriegserlebnissen, nach den Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager zu fragen. Sie, die Schwiegermutter, schon. Bisher hatte er geschwiegen, musste selbst noch verdauen, was unverdaulich war. Dass er viel Unverdauliches im Magen hatte, wusste man allein dadurch, wenn man bei dieser Frage in sein Gesicht sah. Er brauchte Zeit, um fähig zu werden, aus seinem Gefangenenschicksal zu erzählen, diese Zeit wollte sie ihm lassen. Irgendwann würde er beginnen, zu erzählen. Ganz sicher. Und sie würde zuhören, mit dem größten Interesse und Mitgefühl.
Wenn sie ihn in guten zeitlichen Abständen auf seine Zeit im Lager ansprach, abends beim Stricken, wenn sie alle zusammen an dem runden Tisch in der Stube saßen, Hermann mit seiner Zeitung, merkte sie, wie Ella die Augenbrauen hochzog, so nach dem Motto, wie blöd, muss das jetzt sein?
Ella gab sich keine Mühe, ihre Geste vor Hermann zu verbergen, geschweige denn, ihre Gleichgültigkeit zu verbergen. Was hatte er wohl dabei empfunden, wenn er solche Reaktionen von ihr mitbekam? Was hatte er in Stalingrad empfunden, als die Kameraden die Briefe aus der Heimat erhielten?
Nur vier- oder fünfmal müsste die ganze Zeit über einer von Ella dabei gewesen sein, der Gedanke hatte Ella fasziniert, einen Brief nach Stalingrad zu schicken, das nach einem Schild, in Gifhorn an einer Kreuzung aufgestellt, rund 3000 km weit entfernt war, die genaue Kilometerzahl auf diesem Schild war ihr nicht mehr erinnerbar. Tief beeindruckt hatten damals ihre Mädchen von diesem Hinweisschild geredet, genau hier in der Küche, wo sie jetzt saß, sie hatte Ellas Worte noch im Ohr, als Ella den fertig geschriebenen Brief zuklebte: „Boa! 3000 Kilometer bis Stalingrad! Dann ab mit dir, du Brief!“
Wie gut sie sich daran erinnern konnte! Ja warum? Weil der lieblose Beweggrund Ellas, einen Brief an ihren Mann abzusenden, sie damals hatte erschaudern lassen. Nicht Hermann selbst, sondern die Entfernung, in der er sich befunden hatte, hatte den Ausschlag dafür gegeben, dass er einen Brief von seiner Frau bekam: in 3000 km Entfernung. Ja, es war alles genau so gewesen, wie es sich die Töchter vorhin erzählt hatten.
Und nun noch dazu diese Reden über die unwillkommene Heimkehr der beiden Schwiegersöhne, hauptsächlich über Hermanns, nach allem, was er durchgemacht hatte! Und Mathilde konnte sich in etwa vorstellen, was er durchgemacht haben musste, hatte schon von Berichten früherer Heimkehrer gehört, nach denen es nächte- und tagelang grausame Todesmärsche nach der Gefangennahme gegeben hatte. Sogar Einzelheiten hatte sie gehört oder gelesen, vom unbarmherzigen Vorantreiben der stark geschwächten und kranken Gefangenen, bei Frost bis zu 40 Grad Minus, in mangelnder Bekleidung, ohne Pause, Verpflegung und Hilfe für die Kranken, vom massenweisen Zusammenbrechen der Gefangenen und wie sie dann entweder erschossen oder liegen gelassen wurden, um Munition zu sparen. Es dauerte dann bis zu zwei Stunden, bis sie erfroren waren. Die Wenigsten kamen an ein vorläufiges Ziel, ein Sammellager, in denen es ihnen auch nicht viel besser ging als auf den Todesmärschen. Das Massensterben ging weiter.
So was musste Hermann auch miterlebt haben. So was vergaß man nicht. Dann die Jahre in den Lagern mit Krankheiten, Schikane des Lagerpersonals, Flohplagen und Hunger, in denen die Kameradschaft wegen des Kampfes um ein paar zusätzliche Gramm Brot auf der Strecke blieb. Mathilde hatte die Ohren aufgespannt, gehört, was erzählt wurde, hatte darüber gelesen. Sie konnte sich gut vorstellen, wie wund es im Inneren ihres Schwiegersohns aussehen musste.
Einmal hatte er vom Lager Stalingrad erzählt, nichts von sich selbst, sondern von einem Vorfall dort, der alle tief erschüttert hatte. Die Russen hatten im Lager verbreitet, der Oberstleutnant Konrad Freiherr von Wangenheim sei erhängt aufgefunden worden. Entweder Selbstmord oder Mord durch missgünstige Kameraden. Keiner von den Gefangenen glaubte an solche Todesursachen. Später sickerte im Lager durch, was offensichtlich geschehen war: dass er während eines Verhörs erschlagen wurde.
Mathilde hatte gespürt, wie Hermann darunter litt, als er diese Geschichte erzählte, die Geschichte eines untadeligen Offiziers der deutschen Wehrmacht, hochverehrt im Lager und von ihm, dem Gefreiten Hermann Sünders. Er kannte von Wangenheim schon von der Zeit vor dem Krieg her, da hatte von Wangenheim trotz körperlicher Verletzungen einen Sieg für Deutschland errungen: im Springreiten bei der Olympiade 1944.
Wie würde Hermann erst leiden, wenn er seine eigenen Erlebnisse auspackte? Es ginge noch nicht, das hatte sie deutlich gemerkt, als er über das fremde Schicksal des Offiziers von Wangenheim erzählt hatte und sich zusammennehmen musste, um nicht weinend zusammenzubrechen.
Hermann hatte alles überstanden, er war zu Hause. Und dann dies! Das kaltschnäuzige Reden über ihn, von Ella, seiner Frau.
Es war zu viel für Mathilde! Und das an diesem Tag, an dem sie sich auch so schon gesundheitlich schlecht und kraftlos fühlte. Sie blieb noch sitzen, als der Kaffee längst gemahlen war, horchte in die Stube, wo die Töchter sich über anderes ausließen.
Ja, ihre Töchter! Wieder einmal war ihr angst und bange geworden bei ihren herzlosen Reden. Schon als Kinder hatten sie hohle Seelen gehabt, hatten ungerührt zugesehen, als der Vater aus dem Krankenhaus heimkam, noch in Gips die zertrümmerten Knie- und Armgelenke. Schon damals diese Augen in den flachen Gesichtern, die nur schauten, nicht böse, nicht mal ausdruckslos, nicht unfreundlich, nicht freundlich. Schauten, als hätte sie jemand ins Gesicht gemalt, damit es ein Gesicht ergebe, in das man hineinschauen kann wie in jedes andere, das Gesicht eines Menschen, das nur Gesicht war und dabei auch noch hübsch gemalt. Und sie, Mathilde, hatte ihnen hübsche Kleider genäht, damit sie insgesamt hübsch aussahen. Nur bei Luise zeigte sich gelegentlich ein Gefühl, das sich aber immer wieder verflüchtigte, weil sie auf die ältere Schwester fixiert war. Hatte Gott die Mädchen so geschaffen, dachte Mathilde, damit die Leiden der Welt ihnen nichts anhaben konnten? Was für Gedanken!
Sie hatte es doch gar nicht so mit Gott. Gottesdienst gab es, ja, seit sie ein Radio besaßen. Immer sonntags um zehn Uhr morgens, immer wenn sie Kartoffeln schälte. Ein Ritual, das jeden Sonntag gleich war. Wenn man sich in der Stube zum Essen setzte, sonntags eine halbe Stunde früher als sonst, um halb zwölf, ging der Gottesdienst gerade zu Ende, die Glocken läuteten wie zu Beginn der Sendung und hallten dann aus, wie das mitternächtliche Glockengeläut am Heiligen Abend. Heilig Abend ging man anschließend zu Bett, sonntags am Tisch schwieg man danach noch eine Zeit, ging leise mit dem Essgeschirr um, als sei nach dem Ausklang feiertägliche Ruhe angesagt. Ein Familienritual, ein Ritual wie bei Hermann, wenn er von der Arbeit kam und seine Fußlappen abwickelte. Aber das Gottesdiensthören war ein untätiges, während es bei ihm eines mit Handlung war, und es wirkte so, als täte er jeden Griff ganz bewusst. Das andere nur ein Ein schalten des Apparats, ein Zuhören, ein Schweigen. Vielleicht nur aus Gewohnheit. Egal, man mochte es so.
Mathilde dachte wieder an die Töchter, speziell an Ella, die das Ritual ablaufen ließ, ohne sich anmerken zu lassen, ob es ihr was bedeutete oder nicht. Was hatte sie, Mathilde, mal über Ella und Luise zu Emil gesagt, als der noch redete? „Scheint so, als ob unseren Mädchen alles schnurzpiepegal ist, es könnte die Welt untergehen und sie würden es sich ansehen wie einen interessanten Kinofilm. Sie möchten es bequem haben, das schon. Und wenn es nicht bequem ist, denn reden sie drüben aber machen nichts, um es zu ändern, weil auch das Unbequeme ihnen nichts ausmacht.“
Читать дальше