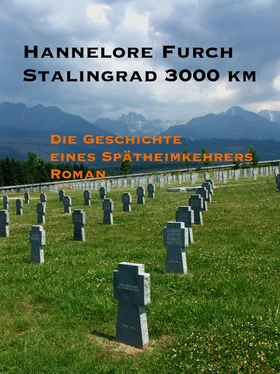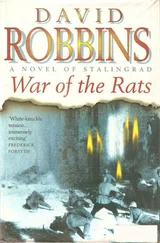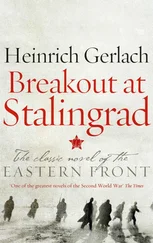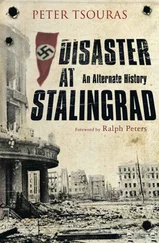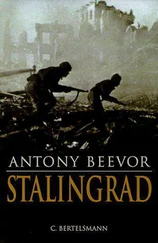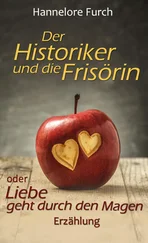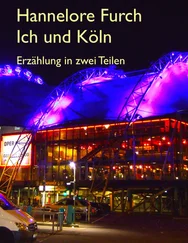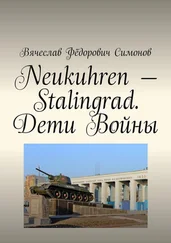Und Emil hatte geantwortet: „Wenn es denen nichts macht, Tilde, ja denn macht es doch nichts.“
Aber traf das heute noch alles so zu? Gerade bei Ella beobachtete sie ein zunehmendes Interesse an allem, was mit dem wirtschaftlichen Fortkommen der Republik in Zusammenhang stand. Es war zwar kein Interesse, das den Mitmenschen zugute kam, aber immerhin ein Interesse. Und Schule und Lehre hatten beide auch gemacht, zu Ende gemacht, und Freundinnen gehabt, liebe Mädchen, die gern mit ihnen zusammen waren, so schien es jedenfalls. Vielleicht war es doch nicht so schlimm mit ihren Mädchen. Ein paar Gegenbeispiele fielen ihr ein, in denen sie die Töchter mildtätig und helfend sah, sodass ihr Zweifel kamen, ob beide wirklich so kalt und herzlos waren, wie sie bei ihren Reden über ihre Männer eben wieder gewirkt hatten.
Uns sie selbst? Mathilde blickte zu ihrem Mann hinüber, der wie immer zusammengesackt in seinem Sessel saß. Vielleicht hätte doch ein Therapeut helfen können und könnte es noch. Das Geld könnte man zusammenkratzen. Aber wollte sie das ernsthaft? Liebte SIE denn ihren Mann? Hatte sie ihn jemals geliebt, diesen alten Mann, der vereinsamt dort am Fester saß, nicht ein einziges Mal hinausschaute ins schöne Dorf, nur dumpf vor sich hinstarrte, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr? Wirklich geliebt, sodass sie für ihn, falls es notwendig geworden wäre, auch persönliche Opfer gebracht hätte? Nein, wirklich geliebt hatte sie ihn zu keiner Zeit. Hatte sie wenigstens Mitleid mit ihm? Nein, heute nicht mehr! Nicht mal ein schlechtes Gewissen.
Die Reden der Töchter verloren für sie an Grausamkeit, als sie deren Lebensweg mit dem eigenen verglich. Wie war es damals, 1919, als sie nach dem Krieg allein nach Köln zog? Dort fand sie eine Stelle als Vorarbeiterin in einer Textilfabrik, nach der sie in Pommern vergeblich gesucht hatte. Und dann in Köln! Ganz allein, ohne Eltern, Geschwister und Freundinnen. Und die ganzen Männer im heiratsfähigen Alter Kriegsinvaliden! Ein paar nicht, der Maschinenschlosser Kowalski, der ihr gleichgültig war. Aber der mochte sie, ließ nicht locker bei ihr, sogar über zwei Jahre hin ließ der nicht locker und passte sie überall ab, während der Engwicht aus der Verwaltung, der auch heil zurückgekommen war und hinter dem sie her war – im Verborgenen, damit er es nicht so merkte und nicht abgeschreckt wurde –, keinen Blick für sie hatte.
Sünders und Littmann gingen sich aus dem Weg, was auf der Baustelle gar nicht so einfach war. Der Trupp bestand aus neunzehn Arbeitern, die während der Frühstückspause im Graben aufgereiht saßen wie die Spatzen auf den Stromleitungen über ihnen. Sünders saß an dem einen, Littmann an dem anderen Ende. Wie üblich führten beide in ihrem Umkreis das Wort, die Unterhaltung zerfiel in zwei Teile und erzeugte eine unsichtbare Spannung, die jedem spürbar war. Es spiegelte sich die Situation zwischen Sünders und Littmann wider, wie sie damals schon bestand, als sich die Dorfjugend an Schumanns Ecke traf.
„Wenn der neue Bautrupp zusammengestellt wird, könnte man einen da unterbringen“, sagte Bakeberg zu Schetter, einem der Vorarbeiter, als beide nach der Frühstückspause noch zusammenstanden. Sie hatten die unangenehme Spannung wieder deutlich gespürt.
„Ja“, sagte Schetter, „aber unser Trupp ist so gut, weil wir die beiden haben, es sind die Zugpferde hier, geben das Tempo vor. Und schließlich kommt die gute Leistung des Trupps uns allen zugute.“
„Wenn die wieder zusammenrasseln, haben wir keinen von beiden mehr“, antwortete Bakeberg.
Die beiden waren eben im Begriff sich zu trennen, hielten im Schreck inne. Knappe zehn Meter von ihnen weg standen sich Sünders und Littmann mit erhobenen Schaufeln gegenüber, als gingen sie jeden Augenblick aufeinander los. Bakeberg fing sich und schrie zu ihnen hinüber: „Runter mit den Schaufeln, seid ihr toll geworden!“
Beide besannen sich schnell, die Schaufeln senkten sich zu Boden, dann die Köpfe. Littmann zog ab, Sünders blieb stehen. Bakeberg sah in die Runde: „Hat doch keiner was gesehen, oder?“ Er ging zu Sünders und warnte ihn: „Will gar nicht wissen, was da wieder war. Das allerletzte Mal, Hermann!“
Ein paar Arbeiter standen noch zusammen. „Bakeberg soll August abgeben in den neuen Trupp“, sagte Grubert zu Werremann, einem Neuen, der erst zwei Wochen da war.
„Wieso August? Den finde ich ganz in Ordnung. Aber den Hermann, mit dem hab' ich so meine Probleme. Der redet manchmal so, als hätte der allein die Knochen hingehalten im Krieg. Andere haben es auch, Littmann, soviel ich schon mitgekriegt hab', in der Normandie. Und wo war der Hermann?“
„In Stalingrad. Angeben tut der ja grade nicht, und spricht ja auch nur über die Ereignisse, nicht über sich selbst. Aber stimmt schon, es kommt dann so rüber, als ob der auf andere Kameraden bisschen herabsieht, die nicht in Stalingrad waren, aber ...“
„Jetzt besser nichts mehr“, schnitt Werremann ihm gereizt das Wort ab, als hätte Grubert seine eigene Meinung geäußert, „mein Bruder ist in Dünkirchen gefallen. Das werd' ich dem Hermann mal auf die Nase binden.“
Dazu suchte er die Gelegenheit und fand sie schon in der Mittagspause, als alle im Graben beieinander saßen und wieder einmal den Krieg nachkarteten.
„Wo warst denn du?, wandte er sich an Hermann und gab sich arglos.
„Ich?“ sagte Sünders, leicht verblüfft darüber, dass Werremann es noch nicht mitbekommen haben sollte, „in Stalingrad.“
„Und wo genau?" „LI. Armeekorps von Seydlitz-Kurzbach, 94. Infanteriedivision. Im Norden standen wir. Einen Tag nach Totensonntag Rückzug, mit Erlaubnis von Seydlitz. Wie wir später erfuhren, gegen den Befehl Hitlers. Hat uns das Leben gerettet, der Seydlitz mit seiner Eigenmächtigkeit. Werde ihm das nicht vergessen. Aber andererseits ist er ein Verräter, der im Lager Krasnogorsk den BDO mitgegründet und ihn dann zusammen mit dem Edlen von Daniels geleitet hat.“
Werremann war zufrieden, so ausführlich Antwort bekommen zu haben. Er tat, als wüsste er über alles Bescheid, was Sünders angeschnitten hatte, und nickte. Im Großen und Ganzen wusste er ja auch Bescheid und konnte ergänzen: „Ihr seid ganz schön mürbe gewesen, was? Rattenkrieg und jede Nacht die Kaffeemühlen am Himmel. Dazu sechzig Gramm Brot am Tag und geschmolzenen Schnee, damit’s runterrutscht. Wundert mich, dass man so überhaupt überleben konnte. Hast sogar die Gefangenschaft überstanden, die die Hölle gewesen sein muss, was man darüber so hört und liest.“
Er machte eine Pause, bevor er innerlich berührt fortfuhr, aber nicht von Sünders‘ Schicksal, sondern von dem, was er selbst gleich erzählen würde: „Ich hab' da einen Freund in der Südstadt, der war im Panzerkorps bei Hube, später noch in Gefangenschaft irgendwo bei Moskau. Ist aber '45 schon nach Haus gekommen, weil der kaputt war, nicht mehr arbeiten konnte. Kenn' den von früher, Karl Brehmer, war ein lustiger Kerl. Dem sind im Winter '41 auf '42 die beiden kleinen Zehen und zwei Finger abgefroren. Papier hatten die um die Füße gewickelt, Socken gab’s ja nicht, weil Hitler, der Irre, verboten hatte, einen Winterkrieg zu planen. Aber wem erzähl' ich das …
Da war bei Karl einer aus der gleichen Straße, sogar Schulkamerad von ihm, den haben sie morgens wecken wollen, weil der nicht aufgestanden war. Und der war ganz steif gefroren. Und vom Hauptmann ging wieder der Brief ab, diesmal nach Gifhorn, ‘gefallen im Heldentod für Volk und Vaterland‘, hätte nicht gelitten, ‘war gleich tot‘, und so. Und später hat der Karl seinen Nachbarn, damit die irgendwie weiterleben konnten, das so bestätigt, ‘war gleich tot‘ und so. Und Karl, der musste mit dieser Lüge leben und lebt heute noch mit ihr. Woher ich das alles weiß? Von meiner Frau, und die hat es von Brehmers Frau, der Else. Die Frauen sind alte Schulfreundinnen. Ein einziges Mal hat Karl alles erzählt, zu Hause, der Else. Und das war's dann, der Karl redet nichts mehr vom Krieg, kein Wort, der hat ein für allemal genug, der schweigt nur noch.“
Читать дальше