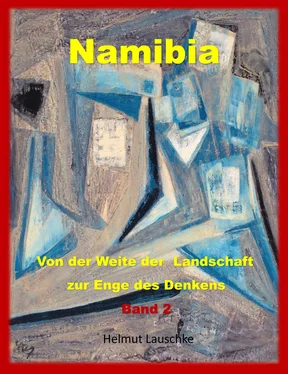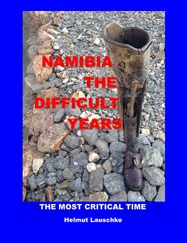Zu diesem Gesicht passte der Würfelkopf, der von vorn und hinten und von den Seiten betrachtet werden konnte, ohne dass das Gesicht das asiatische Lächeln verlor. Es war schon etwas Unglaubliches, in solche Gesichter zu blicken, in die sich die Ereignisse unweit der angolanischen Grenze nicht einzudrücken schienen, wo doch die letzte Entscheidungsschlacht, bei der so viel auf dem Spiel stand, bereits in vollem Gange war. Das sagte jedenfalls der südafrikanische Brigadier, der vom Pulverfass sprach, auf dem die Weißen säßen, das jederzeit hochgehen konnte. Gehörten die Filipinos nicht auch auf dieses Fass, fragte sich Dr. Ferdinand, oder waren sie rassenmäßig von diesem Fasssitzen ausgeschlossen? Er wusste es nicht, erfuhr aber schon nach zwei Wochen, dass ihnen Häuser im Dorf, das durch das Warnschild „For Whites Only“ gekennzeichnet war, von der Administration zugewiesen wurden. Dr. Ferdinand kam beim Sehen und Denken nicht um den biogenetischen wie burisch politischen Januskopf herum. Die Filipinos waren schon im Alter, dass sie von Enkelkindern sprachen und pensionsberechtigt waren. Offensichtlich genügte das nicht, oder ihnen wurde das Recht des Alters nicht vergütet und ausgezahlt, weil das korrupte System im Heimatland ihnen das Pensionsgeld gekürzt oder weggefressen hatte. Es musste etwas mit dem Geld zu tun haben, warum nun diese asiatischen Gesichter mit der spanisch überstrichenen Tradition und dem katholischen Glauben hier auftauchten, davon war er überzeugt. Die Filipinos waren „Practitioners“, also keine Fachärzte, die an den ländlich abgelegenen Hospitälern der herabgesetzten Qualifikation für die Farbigen und Schwarzen vorwiegend in der Natalprovinz, im Osten Südafrikas, gearbeitet hatten, wo die Überfälle der Zulus auf die Weißen dramatisch zugenommen hatten, welche beraubt und getötet wurden, weil sich auch dort die Eingeborenen gegen die Weißen auflehnten und sich auf traditionelle Weise mit Stöcken und Spießen für die schwarze Armut und den weißen Reichtum rächten. Dr. Ferdinand traute den Filipinos, weil sie eben Asiaten waren, die sich über dreihundert Jahre die europäische Verformung mit dem besonderen Sinn fürs Geld draufsetzen ließen, den asiatischen Riecher für die Zukunft in mehr Sicherheit und den westlich verdrehten Verstand zur klaren Berechnung gleichermaßen zu, die sich in Noten und Münzen auch in der Fremdwährung auszahlen mussten. Er nahm deshalb diese lächelnden Janusgesichter, die das Schicksal vom indischen Ozean bis vor die angolanische Grenze gewürfelt hatte, als weiteres Omen für das nahende Ende. Die neuen Kollegen wurden der inneren Medizin mit den Tuberkulosesälen, der Kinderheilkunde und dem „Outpatient department“ zugewiesen, so dass es für die operativen Fächer keinen Ersatz für jene Kollegen in Uniform gab, die nach Dienstableistung nach Südafrika zurückgekehrt waren. Ein Gutes hatte es, dass nämlich unter denen, die das Hospital verlassen hatten, auch der „Leutnant des Teufels“ war, dem ärztlicher Teamgeist von Anfang an zuwider war, weil er die Zerstörung im Kopf hatte, an der er bis zum Schluss mehr interessiert war als an seinen Patienten, und die er hinterhältig und mit List betrieb. Für Dr. Ferdinand bedeutete es mehr Arbeit, weil die Kollegen in der Chirurgie noch unerfahren waren. Es bedeutete gleichzeitig mehr Seelenfrieden, weil ihm keiner mehr mit böser Absicht hinterherstieg. Er freute sich, dass er den jungen Kollegen in der Orthopädie hatte, der sich anstrengte, sich geschickt beim Assistieren und beim Durchführen kleinerer Operationen anstellte und bei den Patienten und Schwestern aufgrund seiner Freundlichkeit beliebt war. Auch hatte er es als Schriftsteller mit seinem Buch weitergebracht, worin er das Leben des jungen Ehepaars in dem kleinen Dorf an der Palliser Bucht nun doch nicht so schwer machte. Der junge Ehemann hatte bereits eine Arbeit als Mechaniker in einer Autowerkstatt in Wellington gefunden, und seine hübsche, junge Frau, die mittlerweile im vierten Monat schwanger war, wurde neugierig angeblickt, doch nun auch freundlich gegrüßt. Der junge Pastor hatte sich gegen die Gemeindemitglieder durchgesetzt und der schwarzen Ehefrau den Zugang zum sonntäglichen Gottesdienst erwirkt. So weit war doch ein Unterschied zum burisch verquerten anachronistischen System der Rassentrennung in Südafrika erkennbar.
Die Sonnenauf- und -untergänge waren so feurig wie eh und je, wenn auch die Sicherheitsmaßnahmen im Dorf sich verschärft hatten und es den Weißen unter Strafe gestellt war, die schwarze „Meme“ ( Putz- und Bügelfrau ) oder irgendeinen Schwarzen über Nacht im Hause schlafen zu lassen. Die Weißen machten sich Sorgen, was kommen würde, und die Angst hatte sich auf ihre Augen gelegt. Keiner traute der Zukunft noch so recht über den Weg, zu verfahren war die politische Kiste. So verwunderte es nicht, dass sich die Gesichtszüge in Richtung einer Selbstrettung nach dem Motto vergröberten: „Rette sich, wer kann!“ Es war Samstagnachmittag. Dr. Ferdinand setzte sich in den blauen Käfer und fuhr zum Postamt, um nach seiner Postbox 1416 zu sehen, die leer war. Er stieg wieder ein und setzte die Fahrt zum Dorfausgang bis zur Sperrschranke fort, wo sich die getarnte doppelte MG-Stellung auf dem Dach des wiederhergestellten Wasserturms befand. Dr. Ferdinand zeigte sein „Permit“ und konnte sitzen bleiben, als zwei Wachhabende in den Innenraum sahen, Motorhaube und Kofferraumdeckel hochhoben und wieder fallen ließen und die Schranke zur Weiterfahrt hochstellten. Der Versuch, die tiefen Schlaglöcher bis zur „T“-Kreuzung der Teerstraße zu umfahren, glückte nicht ganz, so dass die Räder einige Male kräftig hineinschlugen. Er hatte sich vorgenommen, die Fratres in der Missionsstation Okatana zu besuchen, und so bog er nach einem Kilometer von der Teerstraße nach rechts ab und fuhr an den armseligen Wellblechhütten von „Angola“ vorbei, wo die Armut und eine große Zahl angolanischer Flüchtlinge mit ihren kinderreichen Familien hausten. Schlanke Schweine mit faltig hängenden Bäuchen liefen neben mageren Ziegen, denen die Beckenknochen höckrig herausstanden, und rippig felldürren Hunden herum. Sie alle waren auf der Suche nach Ess- und Kaubarem. Unter den Hunden war eine ausgemagerte Hündin mit leeren, faltig hin und her schaukelnden Zitzen, aus denen drei junge Welpen den letzten Tropfen mit hungrigen Mäulern ausquetschten und ungehalten über die magere Ausbeute waren, indem sie in die Zitzen bissen, dass die Mutter vor Schmerzen aufschrie und trotzdem stehen blieb. Die Sandstraße mit den tief ausgefahrenen Reifenspuren der „Casspirs“ begann, und der Käfer schaukelte nach beiden Seiten. Dr. Ferdinand sah links den Wasserturm, von dem aus man ihm bei einer frühnächtlichen Rückfahrt von der Mission zunächst Leuchtkugeln in Blau, Rot und Gelb vor die Windschutzscheibe und schließlich scharf hinterher und nach seinem Leben geschossen hatte. Er bedankte sich noch einmal bei seinem Schutzengel, der ihn mit dem Käfer in eine riesige Sandwolke gesteckt hatte, dass den Augen hinter dem MG das Sehen verging. Die Spuren der „Casspirs“ waren tiefer und zahlreicher als bei seiner letzten Fahrt, was der letzten Entscheidungsschlacht durchaus entsprach, bei der so viel auf dem Spiel stand. Dass sie aber unmittelbar ans Missionsgelände heranführten und den Platz vor dem kleinen Missionshospital und der schlichten Kirche kreuz und quer aufgewühlt hatten, das war ein schlechtes Zeichen. Da musste erst kürzlich etwas passiert sein, denn sonst hätten die Menschen mit den Schwestern und Fratres den Sand schon wieder glatt geharkt, weil sie die Ordnung liebten und den Frieden für den Gottesdienst am morgigen Sonntag brauchten. Das Tor war verkettet. Dr. Ferdinand wartete, bis eine Schwester mit Küchenschürze und Schlüssel aufs Tor zukam, es öffnete und dann wieder verkettete und das Schloss einhängte, als er das Haus der Fratres erreichte und den Käfer in den Schatten einer üppigen Baumkrone abstellte. Die Tür zum langen Flur war nicht verschlossen, so dass er den Weg zum dritten Raum links nahm, in dem drei Fratres saßen, von denen einer bereits betagt war. „Ach, Herr Doktor, das ist ja schön, dass Sie wieder mal kommen, Sie waren lange nicht mehr hier.“ Einer legte den „Osservatore“, das offizielle Vatikanblatt in der deutschen Ausgabe, zusammen und auf den Tisch, der andere hielt die „Deutsche Zeitung“, eine Landeszeitung in deutscher Sprache, in der Hand, als sie einander begrüßten. Dr. Ferdinand setzte sich an den Tisch, auf dem noch einige Palmzweige vom vergangenen Palmsonntag lagen. Der andere Frater legte die Zeitung ebenfalls auf den Tisch zurück. „Wissen Sie“, begann der jüngere Frater, der so jung nicht mehr war, „gestern Abend bekamen wir Besuch von der Koevoet. Die durchsuchten die Mission und das Hospital. Die Koevoetleute sagten, dass sie nach Männern suchen, die vor einigen Tagen aus dem Polizeigewahrsam ausgebrochen waren und bewaffnete Männer der SWAPO seien. Wir konnten da nichts machen, weil sie uns nicht glaubten, dass auf dem Missionsgelände diese Männer nicht sind. Können Sie sich die Aufregung vorstellen, es war doch Karfreitag, und die Menschen bereiteten sich auf das Osterfest vor.“ Die anderen Fratres machten ein ernstes Gesicht, und Dr. Ferdinand konnte sich die Aufregung vorstellen. „Sie haben die ganze Mission durchsucht, sind in jedes Krankenzimmer gegangen, wie die Schwester sagte, dass sich die Patienten erschrocken haben. Sie haben die Räume der Schule und die Wohnstellen der Lehrer kontrolliert, waren in der Küche, wo die Schwester und das Personal noch mit dem Aufräumen und Spülen beschäftigt waren, durchsuchten mit hellen Lampen die Halle, wo die Autos stehen. Sie wollten sogar in die kleine Kapelle, wo die Schwestern ihre Nachtmesse hielten. Da bedurfte es des energischen Einschreitens von uns allen, sie von diesem Wahnsinn abzuhalten. Die Kirche haben sie, Gott sei Dank, verschont. Dann haben sie sich den Nachtwächter vorgenommen, den guten, alten Mann, der hier seit vielen Jahren seinen Dienst tut. Frater Huben sah es, wie sie ihn zwischennahmen. Er eilte ihm zu Hilfe. Der alte Mann konnte sich nicht ausweisen, und die Koevoet war schon dabei, ihn zu verladen, was Frater Huben dann noch mit guten Worten verhinderte. Sie hatten hier nichts gefunden, und das wollten sie nicht glauben. Mit den Autos kurvten sie um die Kirche und leuchteten die Gegend ab. Dann fuhren sie in die umliegenden Siedlungen, durchsuchten Kral für Kral und luden einige Männer auf, die sie mit nach Oshakati nahmen, weil sie keine Papiere hatten.“ Dr. Ferdinand dachte an die letzte Entscheidungsschlacht, die vor der Mission nicht Halt machte und nun bis vor die Tür der kleinen Kapelle heranreichte. Der Frater war erregt: „Und das wenige Stunden vor dem Auferstehungsfest des Herrn. Können Sie sich das vorstellen?“ Es war vorstellbar, denn am Oshakati Hospital ging es noch ganz anders zu, da wurden psychisch kranke Patientinnen mit dem Gewehrkolben geschlagen und Männer, die sich nicht ausweisen konnten, trotz ihrer Gebrechen verprügelt und in die Bäuche der „Casspirs“ geworfen. Dr. Ferdinand fühlte sich genötigt, dazu etwas zu sagen: „Es ist schon traurig, wie rücksichtslos die Koevoet mit den Menschen umgeht. Diesen Leuten ist die Achtung vor dem Menschen völlig abhanden gekommen. Die können nicht schreiben und nicht lesen, aber schlagen, das können sie.“ „Sagen Sie das nicht“, erwiderte der betagte Frater, „einige von denen waren hier in der Schule, und ich habe ihnen das Lesen und Schreiben und die Bibelkunde beigebracht. Und das ist es, was mich traurig macht, dass sie trotzdem den Respekt vor den Menschen verloren haben. Denn was hilft die ganze Schule mit der Bibelkunde, wenn sie später als Barbaren wiederkommen und die Mission auf den Kopf stellen, die sie ehren sollten.“ Dr. Ferdinand verstand die Trauer, dass der Unterricht es nicht geschafft hatte, aus den jungen Menschen durch etwas Bildung ältere Menschen zu machen, die Achtung vor dem Menschen hatten und den menschlichen Respekt höher ansetzten als Geld und gutes Essen. „Diese Menschen haben nichts gelernt“, fuhr der betagte Frater mit dem leicht nach vorn gekrümmten Rücken fort. „Sie sind trotz der Schule böse Menschen geworden, weil sie das Wort Gottes entweder nicht verstanden oder verworfen haben. Sie hätten nach seinem Wort fragen sollen. Sie taten es nicht und verluderten in ihrer geistigen Beengtheit mit der Folge, dass sie das fünfte und die anderen Gebote gedanken- und bedenkenlos übertreten. Das konnte ich damals ihren Kindergesichtern nicht ablesen, als sie vor mir auf der Schulbank saßen. Hätte ich es damals geahnt, ich hätte sie als unbelehrbar nach Hause geschickt, denn so viele Kinder warteten vergeblich auf einen Platz in der Schule, um im Lesen und Schreiben unterrichtet zu werden. Für alle reichten die Räumlichkeiten der Schule nicht, und ich war der einzige Lehrer.“ Das ging Dr. Ferdinand gründlich durch den Kopf, weil er sich fragte, ob ein Lehrer es erwarten durfte, dass alle Kinder gute Menschen werden, wenn sie Unterricht bekommen und noch gute Noten in der Schule schrieben. Die Welt müsste dann doch viel besser sein, wenn die Schule in der Lage wäre, gute Menschen heranzubilden. Doch der Teufel in der Welt ist kein Dummkopf, er führt seine Leute mit blendender Bildung, hoher Intelligenz und einer fertigen Sprache vor, in der hypnotische Kräfte sind, die die menschliche Vernunft ins Verderben schickt. Er fragte deshalb den Frater, ob er das nicht zu pessimistisch sehe. „Mag sein“, antwortete er, „aber glauben Sie mir, ich sage es aus meiner langjährigen Erfahrung, der Spalt zwischen Pessimismus und Optimismus ist ein sehr schmaler. Es bedarf nur eines kurzen Steges, den schmalen Spalt der Realität nach beiden Seiten hin zu überqueren, weil die Realität in einer tiefen Schlucht schlummert und nur wie die Spitze des Eisbergs hervortritt. Natürlich sieht die Eisbergspitze anders aus, je nachdem, wie sie von der Sonne beleuchtet wird, weil eine Seite im Licht und dafür die andere Seite im Schatten liegt, wobei aber der ganze Eisberg gar nicht erst ans Tageslicht kommt. Und da liegt das Problem. Ähnlich ist es mit dem Menschen, wenn er noch auf der Schulbank sitzt, sie sehen ihm in die Augen und glauben seinen Charakter zu erkennen und können es nicht begreifen, wenn er sich ganz anders entpuppt.“ Dr. Ferdinand stieg der Schluchtabbildung nach und fragte ihn, wie er sagen konnte, jene Kinder, die sich später nicht zum reifen Menschen entpuppt hatten, als unbelehrbar nach Hause zu schicken, wenn er es damals geahnt hätte. „Sehen Sie“, sagte der alte Frater, „das Leben ist kurz, und so gibt es nur wenige Chancen, ein Mensch zu werden, während für den Unmenschen die Chancen viel größer sind. Die Kinder mit den harmlosen Gesichtern, die den Keim zur Menschenverachtung bereits in sich trugen, verwehrten anderen Kindern mit denselben Gesichtern der Unerfahrenheit den Schulbesuch, weil es die Räumlichkeiten und ich als einziger Lehrer nicht schafften. Und da bin ich der Meinung, dass da im richtigen Augenblick die falsche Auslese getroffen wurde, weil unter diesen Kindern auch jene Kinder waren, die den Keim zur Menschlichkeit in sich hatten und bedauerlicherweise vom Bildungsprozess ausgeschlossen wurden, weil sie keinen Unterricht im Lesen und Schreiben und der Bibelkunde bekamen. Da mache ich mir den Vorwurf der falschen Auslese, den mir keiner nehmen kann. Oder glauben Sie, dass Sie es besser gekonnt hätten?“ Dr. Ferdinand schaute dem betagten Frater ins Gesicht, der sich die Brille putzte, und musste nach Worten suchen: „Nein, das mit der Auslese zur richtigen Zeit, das hätte ich mit Sicherheit nicht gekonnt, dafür verstehe ich zu wenig vom Menschen.“ „Sehen Sie, nun verstehen Sie mich besser, denn das war mein Problem, das ich nicht lösen konnte, und deshalb halte ich den Selbstvorwurf aufrecht“, sagte der Frater. „Gibt es denn Menschen, die das mit der richtigen Auslese zur richtigen Zeit können?“, fragte Dr. Ferdinand naiv. Der Frater: „Das weiß ich nicht, doch entbindet mich das ungelöste Problem nicht von der übernommenen Verantwortung als Lehrer, selbst wenn es unlösbar ist.“ Dr. Ferdinand erwähnte in diesem Zusammenhang, dass das Problem der menschlichen Geringschätzung auch bei Ärzten vorzufinden war, die aus egoistischen Motiven heraus an der Gemeinschaft wie Ratten nagten, die sich dem Teamgeist widersetzten, weil sie darin keinen Vorteil sahen, die ihn zerstörten, weil sie den Keim der Zerstörung in sich trugen und sich um die Nöte der Patienten nicht kümmerten, weil ihnen die Menschlichkeit fehlte, von der sie nur dann sprachen, wenn es sie selbst betraf.
Читать дальше