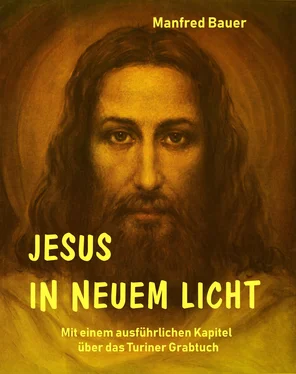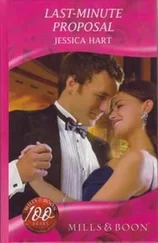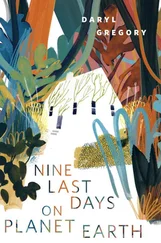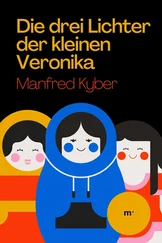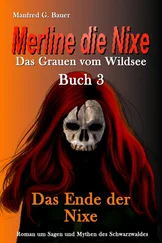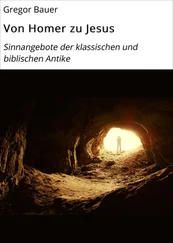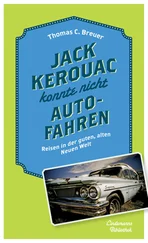Wer einen Beruf wie Josef als Bauhandwerker (griech.Tekton) hatte, konnte sich glücklich schätzen. Wie wir gesehen haben, wird Jesus bei Markus ebenfalls als Tekton bezeichnet – übersetzt mit Zimmermann. Diese Übersetzung ist jedoch nicht ganz korrekt. Die Tätigkeit eines Tektons umfasste alle Arbeiten und auch Planungen, die am Bau anfielen.
Die Vergleiche Jesu, vom „Haus, das auf Sand gebaut ist“, vom „Balken im eigenen Auge“, dem „Splitter im Auge des Bruders“ oder dem „Stein, den die Bauleute verworfen haben“, lassen darauf schließen, dass er Bezug zu diesem Beruf hatte. Er wird als Fachmann Bauherren bei der Suche nach einem geeigneten Bauplatz beraten haben. Und jeder, der mit rohem Holz gearbeitet hat, weiß um die Gefahr, wie schnell man sich dabei einen Splitter in die Haut zieht. Steckt dieser gar im Auge, braucht man die Hilfe eines Arbeitskollegen, um ihn zu entfernen.
Was geschah wohl mit Nazareth, als die Römer im Jahre 7 den Aufstand Judas des Galiläers niederschlugen und das von Nazareth nur etwa 6 km entfernte Sepphoris dem Erdboden gleich machten?
2009 entdeckten israelische Archäologen in Nazareth die Reste eines kleinen Privathauses, das aus der Zeit Jesu stammte. Daneben fanden sie einen Schacht, der den Bewohnern während des jüdischen Aufstands gegen die Römer als Versteck gedient haben könnte. Solche Verstecke fanden sich auch in anderen Gebäuden aus jener Zeit. Maria, Josef und die Kinder könnten sich öfter dorthin geflüchtet haben, wenn plündernde Soldaten ins Dorf einfielen. Da diese jedoch in Sepphoris reiche Beute gemacht hatten, werden sie das armselige Dorf wohl eher links liegen gelassen haben.
Als die Zeiten wieder ruhiger wurden, wird Josef seinen Sohn mit zur Arbeit genommen haben. Beim Wiederaufbau des nahen Sepphoris gab es sicher gute Verdienstmöglichkeiten. Herodes Antipas ließ es nach der Zerstörung durch die Römer in griechischem Stil in solcher Schönheit wieder aufbauen, dass Josephus es als „Das Ornament von Galiläa“ bezeichnete.
Bis Herodes im Jahre 19 in die ebenfalls neu errichtete Stadt Tiberias, am See Genezareth, übersiedelte, war Sepphoris die Hauptstadt Galiläas. Beim Aufbau Tiberias' boten sich Josef mit seinen Söhnen ebenfalls Arbeitsmöglichkeiten.
Allerdings war dies etwa 30 km entfernt, so dass sie nur zum Sabbat nachhause gehen konnten.
Beim Bau der palastähnlichen Häuser für die jüdische, römische und griechische Aristokratie wird in Jesus das soziale Bewusstsein entstanden sein, das in seinen späteren Gleichnissen wie dem „Reichen Prasser“ und dem „Armen Lazarus“, zum Ausdruck kommt. 36
Was veranlasste Jesus, nach Kapharnaum umzusiedeln? War es eine Eheschließung oder Scheidung, ein Zerwürfnis mit der Familie, schloss er sich einer Essenergemeinde an? Wir haben keinerlei Informationen darüber. Kapharnaum war um die Zeitenwende ein größeres Dorf mit etwa 1000 Einwohnern. Die Gebäude aus grob behauenen Feldsteinen, Ställe, Wohn- und Lagerräume gruppierten sich um kleine Höfe, von rechtwinkligen Gassen in regelmäßige Straßenblöcke zerteilt. Familien mehrerer Generationen lebten mit ihren Bediensteten und den Tieren unter einem Dach. Es gab keine großen sozialen Unterschiede. Nahe der Grenze zu Gaulanitis, östlich des Sees, war der Ort Zollstation mit entsprechend viel Durchgangsverkehr.
Wie wohnte Jesus hier? War er verheiratet und wohnte mit den Schwiegereltern unter einem Dach? Wenn er allein lebte, konnte er kein ganzes Gehöft bewohnen. Möglicherweise hatte er sich einer Essener–Gemeinschaft angeschlossen. Ihre tiefe Religiosität dürfte ihn sicher beeindruckt haben.
Gibt es Anzeichen für eine Verbindung Jesu zu dieser Gemeinschaft?
Jesus und die Essener
„Es ist höchst erstaunlich, dass die Essener in Neuen Testament nicht namentlich vorkommen. Ich kenne keine völlig zufriedenstellende Erklärung dieses Umstandes. Sicherlich ist es nicht auf ihre Unbekanntheit zurückzuführen." 37Frank Moore Cross spricht hier ein, für die meisten Bibelwissenschaftler, ungelöstes Rätsel an.
Wie wir bei Josephus Flavius gesehen haben, waren die Essener eine allgemein bekannte und geachtete Gemeinschaft. Wieso nehmen die Evangelisten keine Notiz von ihnen, obwohl deren Gedankengut sich in allen vier Evangelien und einzelnen Paulusbriefen wiederfindet?
So, wie der Gegensatz zwischen Wegen des Lichts und Wegen der Finsternis, der Glaube, dass das irdische Leben nichts ist im Vergleich zur jenseitigen Herrlichkeit, die Verdammung der Ungläubigen, das Lob der Armut, Ablehnung der Tieropfer und auch des Schwörens etc. .
Der jüdische Bibelwissenschaftler Pinchas Lapide glaubt, in den Evangelien Spuren gefunden zu haben, die Verbindungen Jesu zu den Essenern nahelegen. In Markus 14,3 und Matthäus 26,6 ist die Rede davon wie Jesus mit seinen Jüngern … zu Bethanien im Haus e Simons des „Aussätzigen“ … zu Besuch war. Dies ist unmöglich. Ein Aussätziger verunreinigt nach rabbinischem Recht – mehr im kultischen Sinne als durch die Gefahr der Ansteckung – nicht nur alles, was er berührt; schon seine Anwesenheit in einem Haus verunreinigte dieses.
Lapide schreibt: „Denn im Aussatz sah man eine Plage, die unmittelbar von Gott als Strafe für Verleumdung, Hochmut, Blutvergießen, Meineid oder Unzucht verhängt wurde." Und weiter: „Simon, der Gastgeber Jesu, konnte daher als Aussätziger unmöglich in Bethanien … gewohnt haben, noch konnte er ein vom Aussatz Geheilter gewesen sein, der den Beinamen ,Aussätziger‘ trug, da es nach rabbinischem Ethos als schwere Sünde galt, jemandem sein Gebrechen … vorzuhalten ... .“
Er schließt daraus: „Eine Rückhebraisierung ermöglicht die Annahme, dass die Urschrift von einem ,Schim´on ha–Za nua´ sprach, was nur allzu leicht als ,Schim´on ha–Za rua´ verschrieben oder fälschlich entziffert werden konnte – umso mehr, als sich die Buchstaben Nun und Resch in der qumranischen Paläographie ähneln.
Das Letztere aber heißt ‚Simon der Aussätzige‘ ... während das Erstere ,Simon der Essener‘ bedeuten würde." 38
Auch im folgenden Abschnitt sieht Lapide einen Hinweis auf die Essener: Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: „Gehet in die Stadt; da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt; dem folget, und wo er hineingeht, da sprechet zum Hausherrn: Der Meister lässt fragen: Wo ist meine Herberge, in der ich mit meinen Jüngern das Passah essen kann?“ 39Im Orient sind es die Frauen, die Wasserkrüge auf ihrem Kopf tragen. Ein Junggeselle hat dies selbst zu besorgen und fällt dabei natürlich auf. Dies spricht ebenfalls dafür, dass es sich hier um einen Essener handelte, da die meisten unverheiratet waren. 40
Auch der Umstand, dass Jesus so ohne weiteres ein Gemach beanspruchen konnte, spricht dafür, dass er Verbindung zu ihnen hatte. Josephus schildert dies anschaulich:
„Essener, die anderswoher kommen, können über den ganzen Besitz der betreffenden örtlichen Gemeinschaft verfügen wie über ihren eigenen Besitz, und bei Leuten, die ihnen früher völlig unbekannt waren, gehen sie aus und ein wie bei alten Bekannten. Deshalb reisen sie auch ohne jedes Gepäck … . In jeder Stadt, wo sie wohnen, ist einer von ihnen beauftragt, sich um Gäste zu kümmern, um sie mit Speise und allem Notwendigen zu versorgen." 41
Es ist aber klar ersichtlich, dass der Freiheitsdrang Jesu verhinderte, sich vollständig in die Essenergemeinschaft einzugliedern. Seine individuelle, dem Menschen zugewandte Schriftauslegung, über die er sich des Öfteren mit auf den Buchstaben des Gesetzes fixierten Pharisäerkollegen anlegte, ließ sich auch mit den starren Lebensgewohnheiten und Vorstellungen der Essener nicht vereinen.
Читать дальше