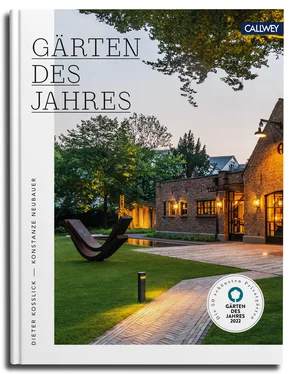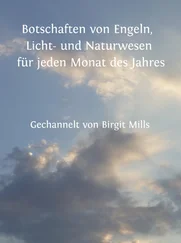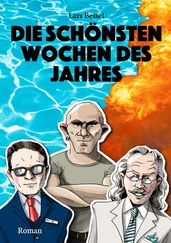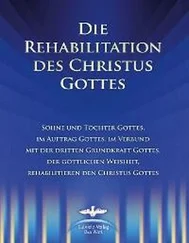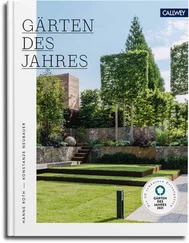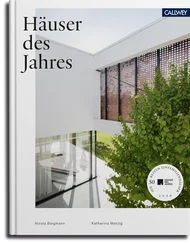EINLEITUNG
von Dieter Kosslick
Wie der Gärtner tickt
1957, als ich gerade mal elf Jahre alt war, hatte ich meine erste Gartenerfahrung bereits hinter mir. In unserem kleinen schwäbischen Dorf besaß fast jeder und jede einen kleinen Garten, privat hinterm Haus oder auf freiem Feld zwischen den Dörfern. Die Gemeinde stellte das Land zur Verfügung. Dort wurde gegärtnert, um eigenes Gemüse zu ziehen, oder auch aus reiner Gartenfreude, oftmals verband sich beides.
1957 war laut einer Statistik „Gartenarbeit“ die zweitbeliebteste Freizeitbeschäftigung nach Zeitungs- und Zeitschriftenlesen. Heute, fast 65 Jahre später, „stehen Internet, Fernsehen und Computer“ auf den vorderen Plätzen.
Doch die Lust am Gärtnern auf eigener Parzelle oder vor den Toren der Stadt ist größer als je zuvor. Junge Familien wollen ihren Kindern zeigen, wie Gemüse wächst und dass die Milch nicht aus Tetra Paks kommt. Auch die stetig wachsende Zahl von Menschen, die unbehandelte und ungespritzte Lebensmittel essen wollen, vervielfacht die Sehnsucht, ein Stück Erde mit eigenen Händen zu bearbeiten.
Kleingärten, Schrebergärten oder Mietgärten mit schönen Namen wie „Glücksgärten“ sind so begehrt wie nie. Wer Glück hat, gehört zu den fünf Millionen „Laubenpiepern“ in einer Kleingartenkolonie. Suchanzeigen im Internet belegen diesen Trend: „Noch nie wurde nach den Begriffen ‚Pflanzen und Gewächshäuser‘ so oft gesucht wie heute. Die Deutschen verbringen danach viel Zeit mit Gärtnern“, so eine Google-Analyse.
Die Einstellung zum Garten und der Natur hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Dieses Vorwort entsteht mitten in der vierten Welle der Pandemie, und es wird auf dem Land, umgeben von einem Park und einem historischen Naschgarten geschrieben. Um mich herum wohnen dauerhaft oder am Wochenende Städter, die der Enge der Stadt entflohen sind. Noch nie ist vielen Menschen so bewusst geworden, was ihnen in dieser Zeit fehlt: Natur und Kultur.
Es geht neben der Sorge um den sicheren Arbeitsplatz immer mehr um gute Lebensmittel und Überlebensmittel wie Theater, Musik, Museen, Kino und Literatur – und Garten, oder präziser gesagt, das Gärtnern. Dem Home- office der isolierten Heimarbeit steht in dieser Zeit das wachsende Bedürfnis entgegen „ins Freie“ zu streben. In Parks und Gärten hinaus in die Natur wie einst die Wandervögel. Nicht nur Hotels und Restaurants wurden in Windeseile nach den Lockerungen der Pandemieregeln auf Monate voraus reserviert, sondern auch die meisten Kulturveranstaltungen. „Ins Freie“ lautete das Motto des Sommerprogramms im brandenburgischen Schinkelschloss Neuhardenberg mit seinem wunderschönen Staudengarten und weitläufigen Peter Josef Lenée-Park. In wenigen Stunden war auch dieses Programm komplett ausverkauft. Die Menschen konnten es nicht erwarten, „ins Freie“ zu kommen, zu Open-Air-Konzerten, Kinoabenden und kulinarischen Arrangements.
Plötzlich realisierten sie, wie eng die doch so hochgelobten Kulturmetropolen wurden und wie groß die Sehnsucht nach frischer Luft ohne Maske.
Eine regelrechte Stadtflucht begann und eine Autostunde rund um Berlin gab es keine Einfamilienhäuser, Datschen und Schrebergärten mehr. Dies markiert nur den vorläufigen Höhepunkt, forciert durch das Virus, was schon länger in den lauten und Abgas-stickigen Städten vor sich geht.
Luftschlösser statt Prinzessinnengarten
Vor einigen Jahren schrieb ich einen Leserbrief zum Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, einem monumentalen postbarocken Betonklotz mit einer 200 m langen, nachgemachten Preußen-Fassade. Wer sich ein solches Schloss, das über eine Milliarde Steuergelder verschlingt, leisten kann, sollte sich auch einen kleinen Prinzessinnengarten gönnen, schrieb ich. Dieser, von jungen Gartenenthusiasten gepflanzte Prinzessinnengarten mitten in Kreuzberg, holte damals die Natur und das Gärtnern in die Stadt zurück und machte urban gardening weltweit bekannt. Und dieser Modellgarten war wieder einmal gefährdet. Das Grundstück liegt im heißen Spekulationsgebiet der Innenstadt. Mit einer Milliarde Euro Schlossaufbauhilfe hätte man die schönsten Stadtteilgärten der Welt anlegen und unterstützen können. Dann wäre sogar noch genügend Geld übrig gewesen, um auf der Wiese des heutigen Schlossgeländes, auf dem Gelände des abgerissenen Palasts der Republik der DDR, einen Garten der Lüste und der Wiedervereinigung, einen riesigen gesamtdeutschen Naschgarten anzulegen. Für eine Zeit lang hätte dieser Garten Ost und West verbunden und alle Nationen zum gemeinsamen Gärtnern eingeladen.
Was für ein verbindendes Paradies, was für ein globaler Integrations-Garten mit Einflüssen aus der ganzen Welt hätte das werden können.
So absurd das vielleicht klingen mag, so absurd wie die verrückte und realisierte Idee, mitten in Berlin heute wieder ein Kaiserschloss aufzubauen, ist die Gartenidee bei Weitem nicht. In seinem engagierten Essay „Die große Illusion – Ein Schloss, eine Fassade und ein Traum von Preussen“ schreibt Hans von Trotha über die nicht enden wollenden Kontroversen über dieses Bauwerk.
Er zitiert den Architekturhistoriker Julius Posener mit einem Gartenvorschlag ganz besonderer Art: Garten statt Schloss. „Mein Vorschlag ist der: Man lasse sich Zeit. Man baue an diese Stelle, ich meine an die Stelle der alten Lustgartenfront eine Front, welche als Durchgang dienen möge: als Durchgang zunächst zu einem Garten. Es ist natürlich im höchsten Maße wünschenswert, dass an dieser Stelle der Stadt einmal ein Gebäude von großer Wichtigkeit für das Leben der Stadt stehen möge: etwas Lebendigeres als das alte verlassene Kaiserschloss. Wir wissen noch nicht recht, was das sein soll. Lassen wir uns Zeit.“
Dies kommentiert Hans von Trotha trocken, „ (…) dass auf diesen Rat gehört werden würde, war von allen die allergrößte Illusion“. Und so steht nun das Schloss. Die gute Nachricht: im Prinzessinnengarten blüht es auch noch, und noch immer gibt es Guerilla-Gardening mit selbst gemachten Blumensamenbomben, die in die Beton- und Schotterritzen der Stadt geworfen werden.
Trotz dicker Luft: Die Pflanzen erobern im Sommer die Städte wieder auf besondere Art. Beerensträucher und Blumen, gierige Kürbisse und Zucchini schlängeln sich mit ihren riesigen grünen Blättern und sonnengelben Blüten über die Geländer kleinster Balkone und durch Minigärten. Wer mehr Platz hat und bereits einen Garten vor den Toren der Metropolen ergatterte, erfreut sich am Staudengärtnern. Aber neben dem legendären Rittersporn und der Schachbrettblume des noch legendäreren Staudenpapstes, Pionier, Gartenphilosophen und Autor zahlreicher Gartenbücher, Karl Foerster, wird jetzt auch in der Stadt für die Küche gegraben und gepflanzt.
Im Stehen, ohne sich zu bücken: Das Hochbeet trat seinen bisher ungebremsten Siegeszug dank der Lust an selbst gepflanzten und essbaren Landschaften an. Pflücksalat, nicht Bücksalat, heißt die Parole. Und statt der nicht enden wollenden Fotos von sensationell designten Sternegerichten, die einem weltweit Speisehedonisten auf das Handy schicken, kommen jetzt, wie Kai aus der Kiste, Fotos der ersten Ernte eigener Rauke, der Radieschen und des gesäten Feldsalates aufs Display.
Auch ich bin dabei. Die vielen frischen Kräuter für das süddeutsche Spargelgericht mit Kratzede meiner Mutter kommen aus meiner Stadtgartenkiste. Kratzede ist übrigens ein Kräuterpfannkuchen, der wie ein salziger Kaiserschmarren in der Pfanne bereits zerteilt wird. Eine köstliche Beilage für weißen und grünen Spargel.
Читать дальше