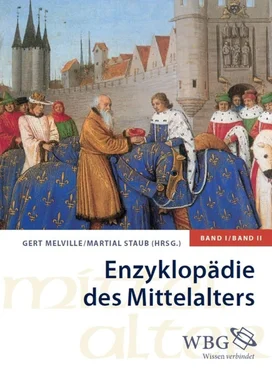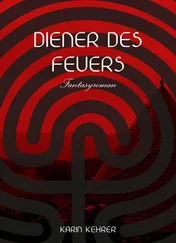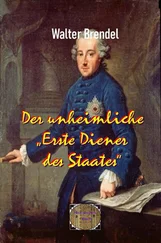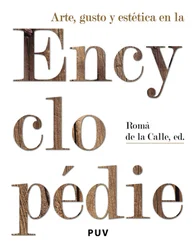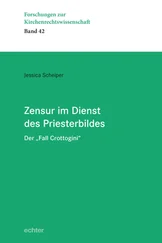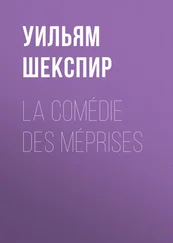Enzyklopädie des Mittelalters
Здесь есть возможность читать онлайн «Enzyklopädie des Mittelalters» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Enzyklopädie des Mittelalters
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enzyklopädie des Mittelalters: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Enzyklopädie des Mittelalters»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Enzyklopädie des Mittelalters — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Enzyklopädie des Mittelalters», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
HERBERT KALB
 Gerichtswesen
Gerichtswesen
Die vielschichtige und zersplitterte Gerichtsverfassung des Mittelalters ist auf das engste mit dem jeweiligen Grad von „Staatlichkeit“ verknüpft und insoweit Spiegelbild des jeweiligen „Verfassungsrechts“.
In der fränkischen Zeit versuchte das Königtum die „aus tribalistischer Tradition unter provinzialrömischem Einfluß geschaffenen Strukturen“ (H. Drüppel) zugunsten eines wachsenden Einflusses des Königtums zu organisieren, was sich im Eindringen königlicher Amtsträger in das volksgenossenschaftlich organisierte Gerichtswesen und im Entstehen eines eigenen Königsgerichts niederschlägt.
Der Graf als königlicher Amtsträger verdrängt den „Volksrichter“, den thunginus, aus dem Gerichtsvorsitz [↗ Ämterwesen]. Nach der grundlegenden Gerichtsreform Karls des Großen hält der Graf höchstens dreimal ein „echtes Ding“, zu dem alle Gerichtsgenossen erscheinen mußten; „Zwischentermine“ nahm das Gericht des Zentenars, das alle 14 Tage und nach Bedarf tagte, ab. Folgenreich war die Kompetenzabgrenzung zwischen dem Grafengericht, das für causae maiores (z.B. Verbrechen, die mit Tod und Verstümmelung bedroht waren; Klagen um Freiheit der Person und um liegendes Gut) zuständig war, und dem Zentenargericht, dem die Klagen um Bußen und Geldschulden sowie Fahrhabe zukamen – die Differenzierung in Hoch- und Niedergerichtsbarkeit kündigt sich an.
Das Königsgericht als Ausfluß des theokratischen Amtsgedankens [↗ Königtum] etablierte sich zunehmend als privilegierter Gerichtsstand für den Adel sowie – wenn auch zögerlich – als Berufungsinstanz. Kraft Evokation konnte der König auch jede Sache an sein Gericht ziehen.
Zentralisierungstendenzen, geprägt von Versuchen, eine durchgängig vom König abgeleitete Gerichtsbarkeit (Bannleihe) durchzusetzen, war allerdings kein Erfolg beschieden. Der bekannte Satz des Sachsenspiegels, daß die gräfliche Gewalt vom König ausgehe, war Postulat, nicht Realität, „dürfte als letzter Versuch, die Verbindung zum Königtum zu wahren, von nur mehr theoretischer oder allenfalls lokaler Bedeutung gewesen sein“ (D. Willoweit). Bereits in fränkischer Zeit etablierten sich als gegenläufige Tendenzen die grundherrschaftliche und kirchliche Immunität und Vogtei. Die durch königliche Privilegien verliehene Immunität schließt die publica iudiciaria potestas aus; deren Aufgaben wachsen den Privilegierten selbst zu. Insbesondere die geistlichen Grundherren (Bischöfe, Klöster) übten diese Rechte nicht selbst aus, sondern betrauten damit einen (adeligen) Vogt (advocatus) [↗ Vogtei]. Das Immunitätsgebiet war der Amtsgewalt des Grafen entzogen (exemtes Gebiet). Das Königtum versuchte mit der Kombination von Königsschutz und Immunität insbesondere die vom Adel gegründeten Klöster und Kirchen an das Königtum zu binden; doch war diesem Weg letztlich kein Erfolg beschieden. Zahlreichen Immunitätsherren gelang es, die Immunitätsgerichtsbarkeit über den eigenen grundherrschaftlichen Bereich hinaus auszudehnen und zu geschlossenen „Bannbezirken“ fortzuentwickeln. Parallel dazu erlangten zahlreiche geistliche Immunitäten auch die Hochgerichtsbarkeit. In dieser Ausprägung in Verbindung mit der Vogtei mutierte die Immunität zu einem eigenständigen Element von Herrschaft im Rahmen des mittelalterlichen Landwerdungsprozesses. Der Adel war Inhaber einer eigenen Gerichtsbarkeit, die Feudalisierung des Gerichtswesens begünstigte den judizialen Partikularismus. Das königliche Hofgericht war in seiner Wertigkeit ein Abbild des reichsständischen Dualismus, was von der älteren Literatur teilweise auf dem Hintergrund eines „Verfallsparadigmas“ skizziert wurde – die Wirkungsgeschichte des königlichen Hofgerichts als Spiegelbild der Geschichte des Verfalls der Königsmacht. Läßt man diese pejorativen Konnotationen weg, ist nur festzuhalten, daß „Unifikationserfolge“ im deutschen Reich den Territorien gelangen; die von den Landesfürsten gemeinsam mit den Landständen ausgeübte Herrschaft gab im Spätmittelalter den großen Rahmen der politischen Ordnung ab.
Diesen zu respektieren bedeutete aber nicht, daß die unzähligen kleineren und größeren Herrschaftsverbände, die unterhalb der Ebene der Landesherrschaft das Land überzogen, übertragene Herrschaftsbefugnisse ausübten. Im Gegenteil: Autonomie war das Kennzeichen mittelalterlicher Herrschaft, die in unterschiedlichen Organisationsformen gelebt wurde. Selbständige Herrschaftsträger waren also nicht nur Landesfürst und Landstände auf der Ebene der Landesherrschaft, sondern Grundherren und Bauern in den Grundherrschaften, Stadtbürger in den Stadtherrschaften, Dorfbewohner in den Dorfgenossenschaften, Handwerker in den Zunftgenossenschaften oder Hausherr und Hausgenossenschaften in den Hausherrschaften. Herrschaftsvielfalt charakterisierte ein mittelalterliches Land, überlagert von der Kirchenherrschaft, die aus dem Glaubensverband herrührte. Alle mittelalterlichen Politikfelder, so auch die Gerichtsbarkeit, wurden von diesen segmentären Herrschaftsbereichen mitbestimmt, weil in ihnen trotz unterschiedlicher wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Zielsetzungen „hoheitliche“ Ordnungsaufgaben wahrgenommen wurden, und zwar nicht im Delegationsweg, sondern aus eigener Kraft. Selbst die Kumulierung von Herrschaftsbefugnissen in der Hand identer Herrschaftsträger – Landesfürst und Adel waren regelmäßig mehrfache Grundherren, Stadtherren, Dorfherren – stabilisierte nur das Geflecht größerer und kleinerer Herrschaftszentren, verdichtete sich aber nicht zur einseitigen Befehlsgewalt des „Mächtigsten“. Zutreffend stellt H. Drüppel daher fest: „Kennzeichnend für die hoch- und spätmittelalterliche deutsche Rechtswirklichkeit ist daher ein struktureller Pluralismus unterschiedlichster, auf allen Ebenen miteinander konkurrierender Gerichtsbarkeiten, der sich in den grundherrlichen, dörflichen, Markt- und Landgerichtsbarkeiten, in den genossenschaftlichen, geburts- und berufsständischen Sonderformen und in deren einander vielfach überschneidenden Kompetenzen widerspiegelt.“
Läßt sich diese partikulare Zersplitterung kaum auf einige wenige „Eckdaten“ reduzieren, so kann das Verfahren „idealtypisch“ auf einige wenige „Modelle“ und Entwicklungslinien verdichtet werden.
Hier geht es um die Entwicklungslinie vom „dinggenossenschaftlichen Verfahren“ zu den Ausdifferenzierungen im gelehrten Recht auf dem Hintergrund der Rationalisierungstendenz seit dem 12. Jahrhundert (Ausdifferenzierung von Zivil- und Strafrecht; Entstehung eines öffentlichen Strafrechts; Inquisitionsverfahren; römisch-kanonischer Prozeß etc.), wovon einige wenige Linien aufgezeigt werden. Allerdings muß man sich bewußt sein, daß das Deutungsschema „irrational – rational“ durchaus plakativ und simplifizierend ist und auch ein Konstrukt moderner Wertung beinhaltet.
HERBERT KALB
 Inquisition
Inquisition
Mit Inquisitionsverfahren ist ein prozessualer Ablauf gemeint, der zu Beginn des 13. Jahrhunderts unter diesem Namen ausgebildet wurde und sowohl in der kirchlichen wie in der weltlichen Gerichtsbarkeit bis weit in die Neuzeit Anwendung fand. Die Entstehung des Inquisitionsverfahrens ist von W. Trusen aufbereitet worden, der in Papst Innozenz III. den Initiator dieses Verfahrens sieht.
Grundsätzlich war der kirchliche Prozeß regelmäßig ein Anklageverfahren, dessen zentrale Eckpunkte dem spätrömischen Akkusationsprozeß verpflichtet waren. Allerdings war dieses Verfahren für die Durchführung einer effizienten Kirchenreform nur mit Einschränkungen tauglich. So erschwerten feste Beweisregeln eine Verurteilung; überdies mußte der Kläger mit der gleichen Strafe rechnen, wenn die Beweisführung mißlang. „Dieses Verfahren“ – so P. Segl – „war für den Kläger nicht nur äußerst riskant, sondern, wenn es sich um Verfahren gegen hohe und mächtige Geistliche handelte, auch gefährlich, so daß sich selbst in Fällen schwerer Verbrechen nicht leicht ein Ankläger fand.“ Innozenz III. griff daher auf das bereits in fränkischer Zeit entstandene Infamationsverfahren zurück, das mit seinen Modifikationen zum Ausgangspunkt des Inquisitionsverfahrens wurde. Das Infamationsverfahren stellte auf den auch im weltlichen Recht geläufigen Reinigungseid ab. Klerikern, die im Wege des Akkusationsprozesses nicht überführt werden konnten, stand bei Vorliegen eines weitverbreiteten Gerüchts (mala fama) die Möglichkeit eines Reinigungseides mit Eideshelfern offen. Die einzelnen Stadien des Verfahrens sind: mala fama bei einer Anzahl von ehrenwerten Personen – wurde mit der Klage gleichgesetzt; eine inquisitio famae von Amts wegen (Offizialprinzip); Reinigungseid mit Eideshelfern. Gelang der Reinigungseid mit den „Leumundszeugen“, hatte ein Freispruch, ansonsten die Verurteilung zu erfolgen. Die Schwierigkeiten dieses Verfahrens für disziplinäres Vorgehen waren Innozenz III. durchaus bewußt. So konnten sich zum Beispiel schwer belastete Kleriker, entsprechende Gewissenlosigkeit vorausgesetzt, leicht freischwören – auch Eideshelfer waren „käuflich“. Innozenz entschloß sich daher, die Bedeutung des Reinigungseides zu verändern, indem er eine Untersuchung des materiellen Wahrheitsgehalts durch den Richter durchführen ließ. Der begründete Verdacht kann nun nicht sofort durch einen Reinigungseid mit Eideshelfern beseitigt werden, sondern „die inquisitio wird zur Ermittlung der Wahrheit durch einen materiellen Beweis, etwa durch Tatzeugen, weitergeführt“ (W. Trusen). Nur wenn eine inquisitio erfolglos blieb, war der Reinigungseid noch möglich. Diese Grundsätze dekretierte Innozenz III. unter anderem in seiner berühmten Dekretale Qualiter et quando vom 26. Februar 1205, die dann Eingang in das 4. Lateranum 1215 fand. Innozenz III. vereinigte erstmals konsequent die drei das Inquisitionsverfahren prägenden Elemente, „das Offizialprinzip, den Untersuchungsgrundsatz und – in Kombination damit – das Prinzip der materiellen Wahrheit“ (A. Ignor).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Enzyklopädie des Mittelalters»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Enzyklopädie des Mittelalters» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Enzyklopädie des Mittelalters» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.