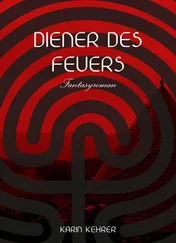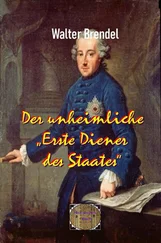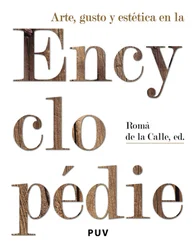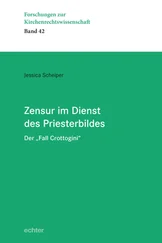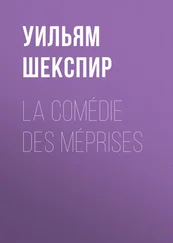Im Anschluß an die aristotelische Tugendlehre entwickelt Thomas von Aquin († 1274) einen Gesetzesbegriff, dessen Konstituenten die rechtsphilosophische Diskussion bis in unsere Tage bestimmten. Nach ihm ist das Gesetz eine Anordnung der Vernunft im Hinblick auf das Gemeinwohl, erlassen und öffentlich bekanntgemacht von dem, der die Sorge für die Gemeinschaft innehat.
In der rechtshistorischen Diskussion ist keine Einigkeit erzielt worden, welche mittelalterlichen Rechtsquellen dem Gesetzesbegriff subsumiert werden können. Die jeweilige Einteilung hängt vom gewählten Gesetzesbegriff ab. H. Krause geht in seinem Beitrag im „Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte“ von „abstrakten Rechtsnormen mit dem Willen zur generellen Geltung aus“, eine Annäherung, die „erst seit dem Aufkommen des modernen Staates im späten Mittelalter einige Richtigkeit beanspruchen (kann)“. Können auf diesem Hintergrund auch frühmittelalterliche Normen als „Gesetze“ bezeichnet werden? W. Sellert behauptet diese Qualität pauschal für die Stammesrechte. Sie seien „eine schriftlich verkörperte und staatsautoritative Fassung von Rechtsregeln“, mit dem Geltungsanspruch gegenüber Dritten, die „nach wie vor mit gutem Gewissen als Gesetzgebungen bezeichnet werden können“. Allerdings, die „staatsautoritative Fassung wie auch der Geltungsanspruch (und die Effektivität) sind in der Forschung bis heute umstritten. Um den Schwierigkeiten eines inhaltlich aufgeladenen Gesetzesbegriffes in seiner Anwendung auf „mittelalterliches Recht“ zu entgehen, stellt A. Wolf primär auf eine formale Begrifflichkeit ab und versteht Gesetz als „allgemeine Rechtsnorm in Urkundenform“. Bezogen auf das Frühmittelalter kann dann zum Beispiel diskutiert werden, ob den Kapitularien „Gesetzesqualität“ zukommt, für die eine „gewisse formale wie materielle […] Ähnlichkeit […] mit Herrscherdiplomen behauptet wird“ (R. Schneider). Doch sind einige Fragezeichen anzubringen. Nach der berühmten Definition von F. Ganshof waren Kapitularien „Erlasse der Staatsgewalt, deren Texte gemeinhin in Artikel gegliedert waren, und deren sich mehrere karolingische Herrscher bedient haben, um Maßnahmen der Gesetzgebung oder der Verwaltung bekanntzugeben“. An dieser Definition ist allerdings nur die Einteilung in Kapitel unumstritten; ansonsten gilt das Diktum H. Mordeks, daß auf dem Feld der Kapitularienforschung nichts so unumstritten sei wie die Divergenz der Meinungen. Für die Eingliederung in die von Wolf gebotene Definition von Gesetz ist die Frage der Schriftlichkeit von Kapitularien essentiell. Wurde lange Zeit in der Forschung im verbum regis das entscheidende Moment für den Geltungsgrund gesehen, so betont R. Schneider die Forcierung von Schriftlichkeit mit einer damit auch verbundenen rechtlichen Bedeutung.
Unübersehbar wird mit dem Arbeitsbegriff Wolfs der Übergang von mündlich festgelegten Rechtsnormen zu schriftlich beurkundeter kontinuierlicher Gesetzgebung im allgemeinen Kontext der Intensivierung „pragmatischer Schriftlichkeit“ (H. Keller) seit dem Hochmittelalter erfaßt. Vor diesem Zeitraum besaßen Reichsitalien und England eine ungebrochene gesetzgeberische Tradition. Im Liber legis langobardorum aus dem 11. Jahrhundert wurden zum Beispiel Gesetze der langobardischen Könige seit Rothari († 652) bis zum Jahre 1052 in chronologischer Reihenfolge aneinandergereiht. Die Überlieferung in England setzt mit der Aufzeichnung von Gesetzen seiner Vorgänger durch Alfred den Großen (871–901) ein.
Aus dem Blickwinkel des Zustandekommens und damit zusammenhängend des Geltungsanspruches unterscheidet Wolf drei Formen: Neben Befehlen eines Herrschers allein, vor allem im Kontext der Beanspruchung des Gesetzgebungsrechts der römischen Kaiser (z.B. Liber Augustalis Friedrichs II. 1231), und Beschlüssen von Ständen allein (vor allem während Thronvakanzen oder Abwesenheit des Königs, zum Beispiel Wormser Statuten des Rheinischen Bundes 1254) ist der Normalfall der Gesetzgebung die Übereinkunft zwischen Herrscher und Optimaten (Ständen). Consilium im Sinne von consensus oder assensus der meliores et maiores charakterisiert die Gesetzgebungstätigkeit des Spätmittelalters. Für diese notwendige Konsensbildung von Herrscher und bevorrechteten Adelspersonen wurde von den Kanonisten durch Neuinterpretation eines Satzes aus dem römischen Vormundschaftsrechts eine Rechtsgrundlage geschaffen, die seit dem 13. Jahrhundert im weltlichen Recht nachzuweisen ist: „Was alle [in ähnlicher Weise] angeht, muß von allen bewilligt werden“ (Quod omnes [similiter] tangit, ab omnibus comprobetur; C 5.59.5.2). Dabei konnten auch „Mischformen“ auftreten. So ist der Reichslandfriede Kaiser Friedrichs I. von Aachen und Köln (1152) als reiner Herrscherbefehl, sein Nürnberger Reichslandsfriede von 1186 de coniventia et consilio principum erhalten. Unter dem Gesichtspunkt der Form sind Einzelgesetze und Gesetzbücher (Codices) zu unterscheiden. Eine Zusammenfassung gesetzgeberischer Tätigkeit in einer Kodifikation wurde im Mittelalter nur in einem Teil der europäischen Länder erreicht. Die erste Kodifikationswelle setzt im 13. Jahrhundert ein, die zweite um die Mitte des 14. Jahrhunderts, eine dritte, die eine Reihe von systematischen Statutensammlungen, die als Ganzes die gesetzliche Sanktion erhielten, hervorbrachte, ging im 15. Jahrhundert über Europa hinweg.
HERBERT KALB
 Privileg
Privileg
Eine begriffliche Erfassung des Privilegs ist für die oral dominierte Kultur bis zum 12. Jahrhundert schwer möglich. Es wurde in dieser Zeit noch keine Theorie des Privilegs entwickelt; die rechtstheoretische Erfassung setzt mit der gelehrten Rechtswissenschaft des 12. Jahrhunderts ein. Isidor von Sevilla († 636) bezeichnete in seinen Etymologiae im Anschluß an das antike Bildungsgut die Privilegien als quasi privatae leges; doch entfaltete diese Unterscheidung eines „privaten“ und „öffentlichen“ Bereichs erst im Kontext des gelehrten Rechts seine Wirkung. Wenn Papst Nikolaus I. als Entstehungsgründe von Privilegien sacri canones, prisca consuetudo und den Willen des Papstes, jemanden quolibet speciali privilegio honorare, nennt, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, daß in den „siècles de silence“ auch im kirchlichen Bereich noch keine Privilegientheorie entwickelt wurde. Für das Frühmittelalter bezeichnet L. Santifaller – inhaltlich ausgerichtet – kirchliche Privilegien „vom Rechtsstandpunkt aus“ als „Bestätigungen und Verleihungen von Sonderrechten mit dauernder Geltung“, wohingegen eine auf Th. Sickel gestützte Tradition die Bedeutung „Vorrechte“ für diese Zeit ablehnt. Diese Differenzierungen sind jedoch auf dem Hintergrund einer fehlenden Privilegientheorie wenig ergiebig. Privilegien enthalten eine neue Rechtsschicht, die sich an bestehendes Recht anlagert; sie sind ein „bevorzugtes Instrument, mit dem man Neuerworbenes, Bedrohtes verteidigt und Verlorenes zurückgewinnt“ (R. Potz).
Orientiert man sich an einer formal ausgerichteten Definition, so ist die Urkundenform der Kernbestandteil des Privilegienbegriffs [↗ Urkunden]. Die fränkische Königsurkunde, welche die antike Tradition des Kaiserreskripts aufgreift, ist der „Prototyp“ des Privilegs im Mittelalter. Privileg und Königsurkunde wurden im zeitgenössischen Verständnis weithin gleichgesetzt. Es ist daher im Sinne einer formalen Annäherung „als Rechtssaussage eines Herrschaftsträgers in Urkundenform“ zu beschreiben. Urheber von Privilegien konnten nicht nur Könige und Päpste sein, sondern neben dem König der Herzog und der Graf, im kirchlichen Bereich neben dem Papst auch Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe – eine abschließende Erfassung der kompetenten Organe läßt sich mangels einer Theorie der Rechtssetzung nicht exakt durchführen.
Читать дальше
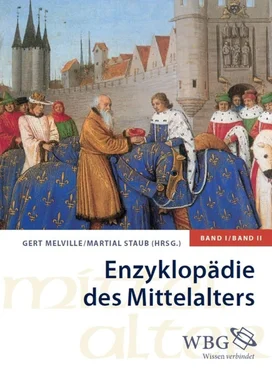
 Privileg
Privileg