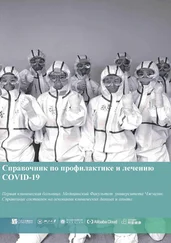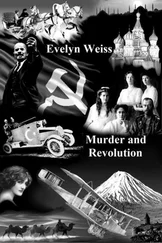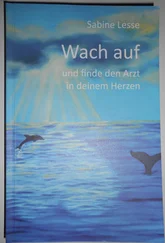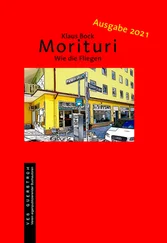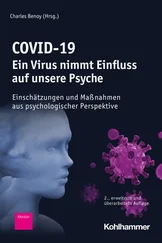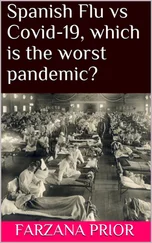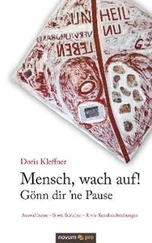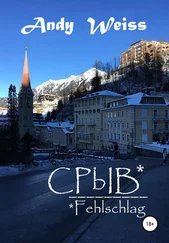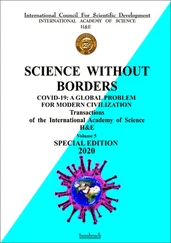Aber die armen, am Ende oder genauer gesagt am Anfang der Billigkonfektionslieferkette sitzenden, dank Auftragsstaus der Modehäuser von der plötzlichen Arbeitslosigkeit bedrohten Näherinnen in Indien, Bangladesch und anderswo werden aufatmen. Wenn endlich die Bestellungen aus den reichen westlichen Nationen kommen, massenhaft solche Gesichtsmasken herzustellen, die in den letzten Wochen in unseren Breiten zu milden Gaben geworden sind, von mitmenschlich denkenden Nachbarn, Freunden oder Verwandten in Fünferpacks in unsere Briefkästen geworfen, in Sorge wegen der besonderen Gefährdung der Risikogruppen: der mit Vorerkrankungen Behafteten oder derer, die die Altersgrenze überschritten haben, der Siebzigjährigen und älter, allesamt potenzielle Patienten mit „letalem“ Ausgang bei einer drohenden Ansteckung.
Dankbar noch über diese milden Gaben nachsinnend – „coming all the way from China“ –, plagt uns andererseits zunehmend der Gedanke, dass es doch angesichts der angekündigten allgemeinen Gesichtsmaskenpflicht zu erheblichen Widersprüchen kommen könnte: wenn man bedenkt, dass das altbekannte generelle Vermummungsverbot in scharfem Gegensatz steht zu Programmen der Gesichtserkennung und dem (die Ausbreitungswege der epidemischen Ansteckung erhellenden) Trackingprogramm, das wir uns möglichst alle total freiwillig auf unsere ambulanten Abhörvorrichtungen – äh, Mobilfunkgeräte – laden sollen. Aber all das sind (für maoistisch geschulte Vollmarxisten) vermutlich nur Widersprüche im Volk, keinesfalls Antagonismen (im Klassenkampf). Und das könnte überraschend wichtig werden. Jetzt, angesichts der kommenden Ostermärsche. Aber andererseits: Wozu haben wir denn eigentlich die Polizei?
(9. April 2020)
Ave Covid, morituri te salutant (6)
Trotz genereller Ausgangsperre haben wir das Osterwochenende in unserer Datscha im Saarland verbracht, in dem kleinen Reihenhaus mit großem, dahinterliegendem Garten, dem zweistöckigen Acht-Zimmer-Häuschen, das als überkommenes Erbe vom einst beachtlich großen Bauernhof des Großvaters übrig geblieben ist. Trotz der angekündigten Polizeikontrollen zur Verhinderung von Wochenendurlauben haben wir die Reise aus der Metropole Frankfurt am Main ins heimelige Nordsaarland gewagt, ausgerüstet für die Rückkehr mit Passierscheinen des Arbeitgebers einerseits und des Dialysezentrums andererseits, darauf vertrauend, zur (wöchentlich) geplanten Heimreise vom Arbeits- respektive Pflegeort im Rhein-Main-Gebiet zu unserem ersten Wohnsitz im Vorland des Hunsrücks berechtigt zu sein.
Dort bei Kaiserwetter im sonnendurchfluteten Garten hinterm Haus auf der Hollywood-Schaukel zu sitzen und Löcher in die Luft zu starren lässt einen in Gedanken zu Tolstois Krieg und Frieden schweifen, in dem die Familien – ähnlich wie wir aus der coronabedrohten Großstadt – mit Kutschen, Kind und Kegel aus dem brennenden Moskau fliehen und auf die Landgüter ihrer Verwandten in den Weiten des ländlichen Russland ausweichen, um dort das friedliche Leben zu genießen und beschauliche Tage zu verbringen, weit ab von der Weltgeschichte und den mit ihr verbundenen schrecklichen Geschehnissen. Zwar fällt für uns die Möglichkeit, in den angrenzenden Wäldern mit Halali hallo auf die Jagd zu gehen, verständlicherweise flach, doch genießen wir die ungewöhnliche Ruhe und den Frieden hier auf dem Land. Selbst vor dem Haus auf der Durchgangsstraße fehlt der sonst übliche Wochenendausflugsverkehrslärm, nicht einmal das von Frühlings- und Sommersonnenwochenenden gewohnte Röhren der Pulks schwerer mehrzylindrischer Motorräder ist zu hören, die gleichsam als „knatterndes Dutzend“ viertelstündlich von Ausflugsziel zu Kurvenstrecke und weiter zum nächsten Ausflugsziel rasen.
Die zahlreichen Polizeikontrollen waren vor allem rund um die wenigen Naherholungsgebiete im Saarland angekündigt, das sich im Rundfunk selbst emphatisch als „das schönste Bundesland der Welt“ tituliert, wie an den beiden Badeseen im Vorderhunsrück, dem Stausee der Bos im Bostal und der durch den Dammbau für die Umgehungsstraße aufgestauten, unter Wasser gesetzten Wiese im Nachbarort, der sich seitdem stolz Losheim am See nennt. Die Parkplätze dort sind sicherheitshalber gesperrt, das Brauhausrestaurant am Ufer der etwas größeren, hüfthohen Regenpfütze, die See genannt wird, ist ohnehin geschlossen. Wir selbst haben weder bei der Hin- noch bei der Rückfahrt irgendwelche Verkehrskontrollen passiert, und am oklahomablauen Frühlingshimmel sind keine Hubschrauber (wie dem Hörensagen nach in Heidelberg, du feine, oder Frankfurt am Main auf der Jagd nach Versammlungsverbotsmissachtern, ja, Kontaktsucher-Tätern) zu sehen, geschweige denn zu hören. Nur die vielen Singvögel zwitschern lauter und vielstimmiger als sonst. Wenn man darauf verzichtet, den Fernseher einzuschalten, und auch den Blick auf die „News“-Spalten des Smartphones verschmäht, verschwinden Hysterie und Aufgeregtheit der Epidemien- und Ausgangssperrenwelt weit, weit, weit hinterm Horizont.
Nur die am Gartenrand zum Nachbargespräch sich einfindenden Familienmitglieder aus den beiden angrenzenden Häusern des Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Drei-Bauernhof-Ensembles wissen zu berichten, erst gestern habe man im Ort eine Gruppe von acht oder neun unverbesserlichen Zusammenstehenden „ufflöse“ müssen. Aber sonst hielten sich alle im Dorf an die Versammlungsverbote. Selbst im Supermarkt in der Nachbargemeinde sei gut einkaufen, jedenfalls an Werktagen, die Woche über, gähnende Leere in den sonst überfüllten Verkaufsräumen, nur die Kleider- und Sonstiges-Regalreihen seien mit Absperrbändern als unzugänglich gekennzeichnet. Lebensmittel hingegen gebe es in Hülle und Fülle, auch Klopapier oder Küchenrollen – kein Problem, alles da.
Dass man sich vorsehen müsse – wir halten fast fünf Meter Abstand, vom Gartenweg über die Beete hinweg zur Nachbargartengrenze –, sei schon wichtig. Alle drei Häuser haben Fälle von Hochgefährdeten im Haus, wegen Multimorbidität; wegen Dialysepflicht hier, generell jedoch wegen der über Siebzigjährigen in allen drei Häusern. Der unmittelbare Nachbar, der kurz nach seinem ersten Schlaganfall das Glück hatte, seine Krankenpflegerin heiraten zu dürfen, ist laut ihrer Aussage froh, wieder zurück zu sein aus der Reha, wohin er nach seinem fünften Schlaganfall musste. Denn in den Pflege- und Altersheimen im Saarland tobt die Corona-Seuche, Hotspots, wie man auf Neu-Corona-Deutsch sagt. Hier zu Hause hat er nur die üblichen Kopfschmerzen, und auf die Straße traut er sich eh nicht. Im übernächsten Haus leidet die Oma unter den Folgen der Chemotherapie, der sie sich wegen Krebs unterziehen musste. Und das, nachdem sie sich nun seit ein paar Jahren abgequält hat mit der äußerst schwierigen und psychisch belastenden Pflege der dementen, im hohen Alter zur kratzbürstigen, schlecht gelaunten Furie gewandelten Uroma, sie, die ihr Lebtag lang vorher ein Engel und ein Ausbund an Geduld und Sanftmut war. Drei Häuser nebeneinander, drei, vier oder fünf Morituri auf engem, nachbarschaftlichem Grund. Anlass genug, mit Außenstehenden möglichst keinen Kontakt aufzunehmen. Währenddessen muss der aufgeweckte fünfjährige Urenkel von der Familie zurückgerufen werden, weil er sich neugierig dem Dialysepflichtigen nähert, um zu fragen, was der denn da mache mit dem kleinen Holzfeuer, das die Glut für den „Schwenker“, wie man im Saarland den Grill nennt, hergeben soll.
Von diesem Nachbarschafts-Shorttalk (Schwätzchen, „majen“ auf Moselfränkisch) abgesehen vergeht das Wochenende mit Gartenarbeit in der Sonne, Freude über die erstmals seit drei Jahren wunderhübsch aufblühende Kamelienpflanze, Genugtuung darüber, dass im kleinen Teich nach Spülung mit frischem Wasser die Algentrübung schwindet und sich herausstellt, dass in diesem Winter alle elf roten, gelben, weiß-roten und blaugrünen Zierfische das tagelange Zufrieren der Teichoberfläche problemlos überlebt haben. Überleben, da machen sie uns Corona-Bedrohten etwas vor.
Читать дальше