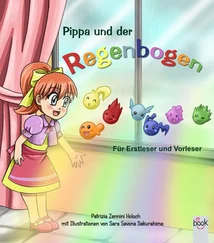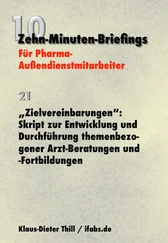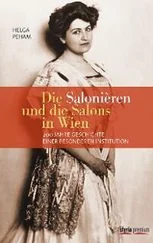Eine Stärkung der Lebenskompetenzen, zu denen die Resilienz zu zählen ist, fordert auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese versteht unter Lebenskompetenzen Fähigkeiten, die Menschen dazu befähigen, effektiv mit den Anforderungen und Herausforderungen des täglichen Lebens umzugehen, und die angemessenes und positives Verhalten fördern (WHO, 1994). Um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sollten folgende Lebenskompetenzen gestärkt werden:
 die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen
die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen
 die Fähigkeit, Probleme zu lösen
die Fähigkeit, Probleme zu lösen
 kreatives Denken
kreatives Denken
 kritisches Denken
kritisches Denken
 effektive Kommunikationsfähigkeiten
effektive Kommunikationsfähigkeiten
 die Fähigkeit, positive zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten
die Fähigkeit, positive zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten
 die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung
die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung
 die Fähigkeit zur Empathie
die Fähigkeit zur Empathie
 die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen
die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen
 die Fähigkeit, Stress zu bewältigen (WHO, 1994).
die Fähigkeit, Stress zu bewältigen (WHO, 1994).
Auch das Bundesgesundheitsministerium formuliert die Bedeutung von Lebenskompetenzen für die Gesundheit von Kindern im Nationalen Gesundheitsziel – Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung. Unter Lebenskompetenzen wird hier die Fähigkeit verstanden, ein gesundes Leben zu führen. Lebenskompetenzen sind kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlernt werden können. Die Lebenskompetenzen werden in einen Zusammenhang zur Bildung gebracht, da Bildung als eine Ressource für erfolgreiche Lebensbewältigung aufgefasst wird. Im Nationalen Gesundheitsziel werden als Lebenskompetenzen folgende angeführt (Bundesgesundheitsministerium, 2010):
 Ich-Stärke: Ich-Identität, Selbstverwirklichung, produktive Anpassung
Ich-Stärke: Ich-Identität, Selbstverwirklichung, produktive Anpassung
 Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz
 Kritikfähigkeit: Selbstwahrnehmung, Kritikannahme, Reflexionsfähigkeit, eigene Urteilsbildung
Kritikfähigkeit: Selbstwahrnehmung, Kritikannahme, Reflexionsfähigkeit, eigene Urteilsbildung
 Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit: Kontaktgestaltung, Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Rollenübernahme
Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit: Kontaktgestaltung, Konfliktfähigkeit, Rollenbewusstsein, Rollenübernahme
 Entscheidungsfähigkeit: reflexiv, sachbezogen, ethisch-moralisch, ästhetisch
Entscheidungsfähigkeit: reflexiv, sachbezogen, ethisch-moralisch, ästhetisch
 Problemlösungsfähigkeit: sachlich, offen, ergebnisorientiert und kreativ
Problemlösungsfähigkeit: sachlich, offen, ergebnisorientiert und kreativ
 Emotionalität und Selbstkontrolle: Wahrnehmen, ausdrücken und steuern von Emotionen
Emotionalität und Selbstkontrolle: Wahrnehmen, ausdrücken und steuern von Emotionen
 Medienkompetenz: Informationsbeschaffung, Wissensaneignung
Medienkompetenz: Informationsbeschaffung, Wissensaneignung
 Handlungsfähigkeit: Selbstwirksamkeit, Erfolgserwartung.
Handlungsfähigkeit: Selbstwirksamkeit, Erfolgserwartung.
Grotberg (2011) formuliert als Essenz aus dem »Internationalen Resilienzprojekt« (einem Projekt, in dem Forschendengruppen aus 30 Staaten zusammengearbeitet hatten) einen Leitfaden, der in der Sprache der Resilienz formuliert ist, wie die Autorin dies nennt. Diese Sprache der Resilienz beinhaltet für verschiedene Altersklassen die drei Faktoren »Ich habe«-, »Ich bin«- und »Ich kann«-Formulierungen. Mit »Ich habe« sind Ressourcen und Strukturen aus der Umwelt gemeint, die resilienzfördernd wirken. »Ich bin« bringt zum Ausdruck, als welche Person sich ein Kind definieren würde, und »Ich kann« beinhaltet die Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Kind sich zuschreiben würde (ebd., S. 51 ff). So sollte in der Sprache der Resilienz ein dreijähriges Kind über folgende Grundlagen verfügen:
Ich habe …
 vertrauensvolle Bindungen
vertrauensvolle Bindungen
 Strukturen und Regeln zu Hause
Strukturen und Regeln zu Hause
 positive Rollenmodelle
positive Rollenmodelle
 Ermutigung zur Autonomie
Ermutigung zur Autonomie
 Zugang zu Gesundheitsdiensten und Erziehungshilfen (ebd., S. 71 f).
Zugang zu Gesundheitsdiensten und Erziehungshilfen (ebd., S. 71 f).
Ich bin …
 liebenswert
liebenswert
 kann mich ansprechend verhalten
kann mich ansprechend verhalten
 liebevoll, empathisch, altruistisch
liebevoll, empathisch, altruistisch
 stolz auf mich
stolz auf mich
 autonom und verantwortlich
autonom und verantwortlich
 voll Hoffnung, Glauben und Vertrauen (ebd., S. 72 f)
voll Hoffnung, Glauben und Vertrauen (ebd., S. 72 f)
Ich kann …
 kommunizieren
kommunizieren
 Probleme lösen
Probleme lösen
 mit meinen Gefühlen und Impulsen umgehen
mit meinen Gefühlen und Impulsen umgehen
Читать дальше
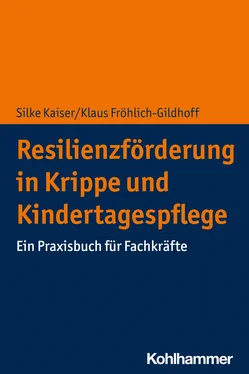
 die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen
die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen