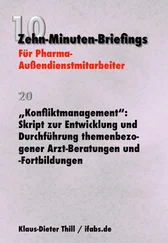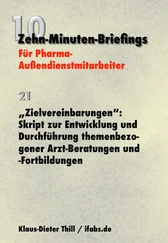Zielstrebigkeit und das Bewusstsein von Sinnhaftigkeit
Zielstrebigkeit und das Bewusstsein von Sinnhaftigkeit
 Positive Sicht auf sich selbst, Selbstwirksamkeit
Positive Sicht auf sich selbst, Selbstwirksamkeit
 Positive Gewohnheiten und Routinen
Positive Gewohnheiten und Routinen
Gartland et al. (2019) stellen in einem systematischen Review von 30 Studien, die sich mit den Resilienz-Outcomes von Kindern, welche sich mit sozialen Widrigkeiten wie Misshandlung, Armut und Krieg konfrontiert sahen, fest, dass sich als beste Resilienzfaktoren kognitive Fähigkeiten, schulisches Engagement, Emotionsregulation und Beziehungen zu den Bezugspersonen ergaben (Gartland et al., 2019).
Aus 19 vorliegenden Resilienzstudien extrahierte Rönnau-Böse (2013) sechs Faktoren, die sich in jeder der Studien als schützender Faktor erwiesen. Diese eingegrenzten Resilienzfaktoren sind den Schutzfaktoren zuzuordnen. Sie sind Kompetenzen des Kindes und entwickeln sich in der Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt. Sie können somit im Umgang mit dem Kind gefördert werden. Die Resilienzfaktoren, die an dieser Stelle nur knapp, in Kapitel 6 (  Kap. 6) ausführlicher beschrieben werden, sind
Kap. 6) ausführlicher beschrieben werden, sind
(1) Positives Selbstkonzept/Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
(2) Selbstregulation
(3) Selbstwirksamkeit
(4) Soziale Kompetenz
(5) Aktive Bewältigungskompetenz
(6) Problemlösefähigkeiten (Rönnau-Böse, 2013).
1. Selbst- und Fremdwahrnehmung
Selbstwahrnehmung umfasst vor allem die ganzheitliche und adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen, Handlungen und Gedanken. Gleichzeitig spielt die Selbstreflexion eine Rolle, d. h. die Fähigkeit, sich zu sich selbst in Beziehung setzen zu können. Fremdwahrnehmung meint die Fähigkeit, andere Personen und ihre Gefühlszustände angemessen und möglichst ›richtig‹ wahrzunehmen bzw. einzuschätzen und sich in deren Sicht- und Denkweise versetzen zu können.
2. Selbstregulation/-steuerung
Sich selbst regulieren zu können, umfasst die Fähigkeit, eigene innere Zustände, also hauptsächlich Gefühle und Spannungszustände herzustellen und aufrecht zu erhalten und deren Intensität und Dauer selbständig zu beeinflussen bzw. kontrollieren zu können – und damit auch die begleitenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen zu regulieren. Dazu gehört bspw. das Wissen, welche Strategien zur Selbstberuhigung und Handlungsalternativen es gibt und welche individuell wirkungsvoll sind.
3. Selbstwirksamkeit
Selbstwirksamkeit ist vor allem das grundlegende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können. Eine große Bedeutung haben dabei die Erwartungen, ob das eigene Handeln zu Wirkungen (und Erfolgen) führt oder nicht. Diese Erwartungen steuern schon im Vorhinein das Herangehen an Situationen und Aufgaben, damit auch die Art und Weise der Bewältigung, und führen so oftmals zu einer Bestätigung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens. Selbstwirksame Kinder und Erwachsene haben auch eher das Gefühl, Situationen beeinflussen zu können (sog. internale Kontrollüberzeugungen) und können die Ereignisse auf ihre wirkliche Ursache hin realistisch beziehen (realistischer Attributionsstil).
4. Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz umfasst die Fähigkeit, im Umgang mit anderen soziale Situationen einschätzen und adäquate Verhaltensweisen zeigen zu können, sich empathisch in andere Menschen einzufühlen sowie sich selbst behaupten und Konflikte angemessen lösen zu können. Es geht aber auch darum, auf andere Menschen aktiv und angemessen zugehen zu können, Kontakt aufzunehmen sowie zwischenmenschliche Kommunikation aufrecht zu erhalten und adäquat zu beenden. Des Weiteren zählt zur sozialen Kompetenz die Fähigkeit, sich soziale Unterstützung zu holen, wenn dies nötig ist.
5. Problemlösen
Unter Problemlösen wird die Fähigkeit verstanden, »komplexe, … nicht eindeutig zuzuordnende Sachverhalte gedanklich zu durchdringen und zu verstehen, um dann unter Rückgriff auf vorhandenes Wissen Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich umzusetzen« (Leutner, Klieme, Meyer & Wirth, 2005, S. 125). Dabei ist es wichtig, systematisch vorzugehen und dabei das jeweilige Problem zu analysieren, Lösungsmöglichkeiten, -mittel und -wege abzuwägen und dann gleichfalls systematisch auszuprobieren. Dabei können unterschiedliche Problemlösestrategien – z. B. eine sorgfältige Ziel-/Mittelanalyse – angewandt werden.
6. Aktive Bewältigungskompetenzen
Menschen empfinden den Charakter von belastenden und/oder herausfordernden, als »stressig« erlebten Situationen unterschiedlich. Es geht darum zu lernen, solche Situationen angemessen einschätzen, bewerten und reflektieren zu können – um dann die eigenen Fähigkeiten in wirkungsvoller Weise zu aktivieren und umzusetzen, um die Stress-Situation zu bewältigen. Bedeutsam für den Umgang mit Stress ist dabei das aktive Zugehen auf solche Situationen und der aktive wie angemessene Einsatz von Bewältigungsstrategien. Zum adäquaten Umgang mit Stress gehört allerdings ebenfalls das Kennen der eigenen Grenzen und Kompetenzen – und die Fähigkeit, sich (dann) soziale Unterstützung zu holen.
Die Resilienzfaktoren sind nur analytisch zu trennen und sind z. T. deutlich miteinander verbunden: So setzen gut ausgebildete soziale Kompetenzen bspw. eine adäquate Selbstregulation voraus. Die Resilienzfaktoren entwickeln sich im Lebenslauf, zunächst durch die Unterstützung von Bezugspersonen; und sie sind wichtige Ansatzpunkte bei der alltagsintegrierten Resilienzförderung (  Kap. 6).
Kap. 6).
Einzig die Resilienz auf der Ebene der Interaktionen zwischen Fachkraft und Kind zu unterstützen, ist jedoch nicht ausreichend, um dauerhaft eine resilienzfördernde Einrichtung zu werden. Stattdessen sollte die Resilienzförderung eingebettet sein in weitere Maßnahmen, wie Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020) betonen: Leitbildentwicklung, Förderung der Resilienz im pädagogischen Alltag und mittels Programmen, Zusammenarbeit mit Bezugspersonen, Aufbau eines Netzwerks sowie die Evaluation eigener Maßnahmen und Angebote.
Doch warum sollte mit der Förderung von Resilienz (psychischer Widerstandskraft) so früh wie möglich begonnen werden? Um diese Frage zu beantworten, lohnt ein Blick in aktuelle Zahlen hinsichtlich der psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Aufschluss gibt eine vom Robert-Koch-Institut durchgeführte Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS-Studie). Dies ist eine Studie, die zu erfassen sucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre auftreten. Zu psychischen Störungen im Kindesalter zählen unter anderem Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpassungsstörungen, Schlafstörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und emotionale Störungen (Steffen, Akmatov, Holstiege & Bätzing, 2018). Aktuelle Zahlen zeigen, dass 16,9 % der 3–17-jährigen Kinder und Jugendlichen Anzeichen für psychische Auffälligkeiten aufweisen (Klipker, Baumgarten, Göbel, Lampert & Hölling, 2018). Dabei hatte die Altersklasse der 3–5-jährigen Jungen einen besonders hohen Anteil (Baumgarten, Klipker, Göbel, Janitza & Hölling, 2018). Psychisch auffällig werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, »wenn ihr Verhalten und Empfinden hinsichtlich des Entwicklungsstandes und den gesellschaftlichen Erwartungen nicht der Norm entspricht« (ebd., S. 60). Es wird jedoch betont, dass diese Auffälligkeiten bei einem Teil der Kinder binnen eines Jahres wieder aufhören, bei einem anderen Teil der Kinder länger anhalten oder gar stärker auftreten (ebd.). Diese Ergebnisse wurden aus einer Befragung von Eltern 3–17-Jähriger gewonnen, sind also nicht ganz passgenau für die Zielgruppe der Unter-Dreijährigen. Ein niedriger sozioökonomischer Status und ein negatives Familienklima haben negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Kinder (ebd.). Aus Zahlen wie diesen lässt sich jedoch die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer frühen Förderung der seelischen Gesundheit und psychischen Widerstandskraft ableiten.
Читать дальше

 Zielstrebigkeit und das Bewusstsein von Sinnhaftigkeit
Zielstrebigkeit und das Bewusstsein von Sinnhaftigkeit Kap. 6) ausführlicher beschrieben werden, sind
Kap. 6) ausführlicher beschrieben werden, sind