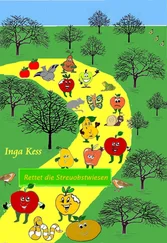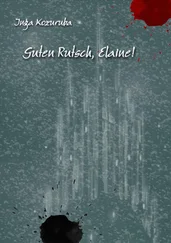Meinem ersten Impuls folgend sprang ich auf und wurde sofort wieder an mein schmerzendes Knie erinnert. Im Schwung gebremst, jedoch wild entschlossen ging ich hinunter in die Küche. Ich würde sie zur Rede stellen, ihr keine Chance lassen. Ich würde mein Stofftier zurückfordern. Diesmal war sie einfach zu weit gegangen.
Schon oft hatte sie Spielsachen und Plüschtiere an meinen Neffen Tristan verschenkt. Oft kam er nach der Schule mit zu uns, damit Carla in Ruhe arbeiten konnte, was auch immer es in diesem Fall heißen mochte, denn eigentlich war sie den ganzen Tag zu Hause und machte sich nur für wohltätige Zwecke und nur in aller Öffentlichkeit die Finger schmutzig. Ihr Mann, ein etablierter Kinderarzt, holte ihr die Sterne vom Himmel und eine Putzfrau nebst Haushälterin ins Haus. Tristan jedoch wuchs nahezu bei uns auf, das war der Wunsch meines Vaters und was er wünschte, wurde gemacht. Dass er bei uns kein eigenes Zimmer hatte, lag an der Tatsache, dass mein Vater mich für zu verwöhnt hielt und der Meinung war, dass teilen mir gut täte. Und so teilte ich. Meine Spielsachen, die ständig durch Neue ersetzt wurden, mein Zimmer, das ich abends immer wieder aufräumen musste, eigentlich.
Meinen Esel wollte ich nicht teilen! Also ging ich sicheren Mutes aus der Küche, nachdem ich dort meine Mutter nicht gefunden hatte, und steuerte das Wohnzimmer an. Gerade als ich eine der beiden Türen öffnen wollte, erstarrte ich mitten in der Bewegung, hielt die Luft an und wünschte mich unsichtbar. Regungslos harrte ich aus und lauschte auf die Stimmen, die durch die geschlossene Flügeltür an mein Ohr drangen. Der Fernseher lief, wurde jedoch von der tiefen, sonoren Stimme meines Vaters übertönt. All mein Mut war einer Art Panik gewichen, hatte sich aufgelöst in Schuldgefühl und Hilflosigkeit. Es ging um mich, meinen Esel. Meine Mutter hatte ihn tatsächlich an Tristan verschenkt und war dann losgefahren, mir einen Neuen zu kaufen. Das sei nicht Sinn der Sache, brüllte mein Vater.
„Hätte ich ihr Stofftier ohne Ersatz weggeben sollen“, widersprach meine Mutter.
„Sie hat alles, was sie braucht, das Kind ist zu verwöhnt“, konterte mein Vater. „Sie muss lernen zu verzichten“, fuhr er in immer aufdringlicherem und unerbittlichem Ton fort.
„Wir hatten damals im Krieg auch nichts, nicht einmal genug zu Essen war da. Ich weiß, was es heißt zu hungern, das bisschen Magenknurren, das ihr als Hunger bezeichnet, ist weit davon entfernt von dem, was wir durchmachen mussten!“
Sag jetzt nichts, sag einfach nichts mehr, schrie es in mir auf, flehte es in mir, doch meine Mutter hörte meine Gedanken nicht. Tapfer gab sie Kontra, verteidigte ihr Handeln, verteidigte mich. Lauter, immer lauter wurde mein Vater, schrie, brüllte, bis sich seine Stimme überschlug. Dann war es schlagartig still. „Er hat sie umgebracht!“ hämmerte es durch meine Starre.
Schritte näherten sich der Tür. Mein Magen krampfte sich zusammen. Mir wurde übel und schwindlig. Ich schloss die Augen, wollte nicht sehen, was sich vor meinem inneren Auge abbildete, was ich erwartete. Die Türen zum Salon wurden geöffnet. Immer noch hatte ich meine Augen fest geschlossen, kniff sie so stark zusammen, bis ich anfing, Sternchen zu sehen, die blitzartig aufleuchteten und durch Lichtimpulse im Takt meines Herzschlages, der wild und rasend durch meinen Kopf tobte, ersetzt wurden.
„Was soll das“ raunte mich mein Vater an und wankte an mir vorbei.
„Was machst du da?“ hörte ich die entsetzte Stimme meiner Mutter.
„Sie lebt!“, die Faust, die sich fest um meinen Magen geschlossen hatte, löste sich, der Boden unter meinen Füssen schwankte nicht mehr und die Blitze im Kopf hörten auf. Nur mein Puls raste ungebremst durch meinen angespannten Körper. Langsam öffnete ich die Augen und sah meine Mutter vor mir. Mit hochrotem Gesicht stand sie vor mir, sah mich erschrocken und besorgt an und wartete geduldig, bis ich mich aus meiner Starre gelöst hatte. Erleichterung, warme, alles überflutende Erlösung ergriff von mir Besitz.
„Ich hab dich ja so lieb“ heulte ich in ihren Armen und nahm mir in diesem Moment vor, sie nie mehr los zu lassen. Sollte doch Tristan meinen Esel behalten, ich würde ihn nicht wieder haben wollen. Und der Neue, der würde einen Ehrenplatz zwischen dem ausgetauschten MonChhichi, dem meine Mutter einen dunkelgrünen Pullover gestrickt hatte, und meiner Schlümpfesammlung, in meinem Regal bekommen, schließlich war meine Mutter für ihn gestorben, beinahe.
Nach einer kleinen Ewigkeit, die ich meine Mutter so umklammert hielt, schob sie mich vorsichtig von sich und sah mich an. Ihre Augen waren rot und in ihrem linken Augenwinkel blitzte eine Träne auf. Sie hatte geweint, sie hatte wegen mir geweint. Nur weil ich mein Kummertier so sehr geliebt hatte und sie für mich um es gekämpft hatte. Langsam löste sie sich aus meiner Umarmung und deutete auf die große Standuhr am Fuße der Treppe. Gerade setzte sie ihr mächtiges Schlagwerk in Gang. Das ganze Haus wurde mit ihrem schwingenden Wohlklang erfüllte.
„Es ist höchste Zeit“, sagte sie leise und drückte mich die erste Stufe der Treppe hinauf. „Morgen wird wieder ein langer Tag“.
Bedacht strich sie mir über meine wilde, lockenschwere Mähne, nahm mein Gesicht in ihre Hände und küsste mich sanft auf die Stirn. Dann schickte mich endgültig in mein Zimmer. Ja, morgen würde wieder kommen und wieder und wieder, so war das nun mal, aber zuerst kam die Nacht und mit ihr meine luftigen Freunde.
Als ich endlich mein Zimmer betrat, lag es in dunkelstes Rot getaucht vor mir. Schemenhaft hoben sich Möbel und Spielsachen gegen die einfallende Dunkelheit ab. Ohne den Lichtschalter zu betätigen, steuerte ich auf mein Bett zu, das sich bereits in Nachtblau gewandet hatte. Vor diesem stehend befreite ich mich mit geübter Bewegung nahezu gleichzeitig aus T-Shirt, Hose, Socken und Sandalen. Alles sank vor mir zu einem Häufchen Irgendetwas auf dem Boden zusammen, wurde abgestreift wie der Tag, mit all seiner Aufregung, fand Befreiung in der sich ankündigenden Nacht.
Zielsicher fuhr ich mit der rechten Hand unter meine Bettdecke, die ordentlich doppelt gelegt darauf wartete, aufgeschlagen zu werden. Schnell hatte ich mein Apfelnachthemd, ein langes Baumwollhemd rundum bedruckt mit in Rottönen gehaltenen Äpfeln, hervorgezogen, zog es an und schlüpfte unter meine Apfelbettdecke. Zwar waren die Äpfel auf meinem Bettbezug grün, doch wer sah das schon, wenn es dunkel war. Apfel war Apfel und ich mitten darin. Verschmolzen mit roten und grünen Früchten, unsichtbar.
Kühl umfing mich das duftige Weich meines aus Federn gemachten Nestes, hüllte mich ein, entführte mich in eine schwere, mysteriöse Welt aus bunten Bildern und wirren Gefühlen. Den Sand zwischen meinen Zehen spürte ich nur kurz, zu kurz, als dass er mich noch stören konnte, bevor ich das Portal zu meiner Traumwelt durchschritt.
Sie traten vor mich, tanzten um mich herum, verhöhnten mich. Ab und zu bekamen sie graue steinerne Gesichter, grinsten mich an und verschmolzen wieder mit dem kalten Grau des Steines, aus denen sie gemacht waren. Kieselsteine, überall Kieselsteine. Polternd setzten sie sich in Bewegung, kamen direkt auf mich zu, drohten mich zu überrollen, mich unter sich zu begraben. Erschrocken wachte ich auf, doch das Rumpeln war immer noch hörbar. War ich wirklich wach oder schlief ich noch? Was für ein Traum, ging es mir noch durch den Kopf, bevor ich endgültig meine Augen öffnete und erschrocken zusammenfuhr. Ein grelles Licht erhellte einen kurzen Augenblick mein Zimmer, bevor es wieder stockdunkel wurde. Und da war es wieder, dieses tiefe gewaltige Grollen, weit weg und doch bedrohlich nah. Nein, keine Kieselsteine, die mir nach dem Leben trachteten.
Die schwülwarme Sommernachtsluft stand in meinem Zimmer, erstickte mich geradezu. Nichts war zu hören, kein Zirpen der Grillen, die, so schien es gerade nachts, wenn keiner hinsah, besonders inbrünstig auf Partnersuche gingen. Keine tanzenden Schatten, die mich in ihre luftig leichte Welt mitnahmen, nur ein bizarres, eisblaues Aufzucken langer Schatten in heißer Nacht, gefolgt von tiefem, mächtigem Grollen voller Wut und Gewalt, Naturgewalt.
Читать дальше