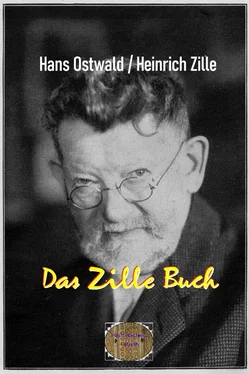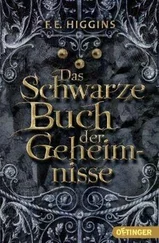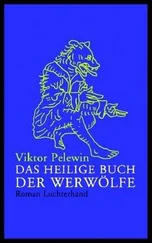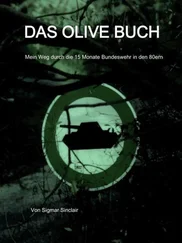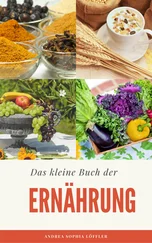Ja, ich wollte doch auch was für mich machen.
Was Ganzes wollte ich machen.
Ich wollte was machen, aus mir heraus.
So, wie ich die Welt und die Menschen sah.
Ich sah sie doch ganz anders, als die andern.
Und das musste ich eben machen ...«
*
»Alle möglichen und unmöglichen Kunstjünger – und solche, die sich dafür halten, schicken einem Proben oder rücken einem sogar selbst auf die Bude. Oder die lieben Eltern oder Onkels kommen und bringen Proben.
Ja, was soll man dazu sagen?
Soll man die Verantwortung auf sich laden, dass da wieder so 'n Kunstproletarier erzogen wird? Ich sage meist:
›Werdet Schofför; die leben wenigstens nicht lange – die haben aber Brot‹ ...
Weiß man, wie solch Mensch sich entwickelt?
Manch einer macht als Kind so viel Versprechungen – macht die schönsten Bilder. Überhaupt, wenn Vater selbst Künstler ist oder in der Familie allerlei Liebhaberei getrieben wird. Dazu kommt dann solche kindliche Ursprünglichkeit – und das Genie ist fertig.
›Unser Peter braucht doch kaum was zu lernen – ach, der braucht gar nicht mehr zu lernen. Sehen Sie nur, was der kann!‹
9. Die Jungfernbrücke im Schnee zeichnete Zille, nachdem er, nachts aus einer Kaschemme heimkehrend, sie im frischen Schnee gesehen. Er benutzte diese Skizze zu einem Rodelbild, und zu der Zeichnung, auf der die noch »immer frisch vom Lande« gekommene Dirne die Männer anspricht.–
Und es ist auch manchmal überraschend, was so'n Junge kann. Ja – und dann, wenn die Pubertät vorbei ist – dann soll er selber Charakter haben – und Fleiß – und Erfindung –
Und denn ist er ein hohles Ei. Ausgepustet ....
Nee – ich nehme die Verantwortung nicht auf mich.
Ich sage immer:
›Gehn Sie man auf die Hochschule und holen Sie sich da Bescheid. Die Leute da sind angestellt und werden dafür bezahlt‹ ...«
*
In seinen früheren Jahren ist Zille von manchen Geschäftsleuten rücksichtslos ausgebeutet worden. Seine Zeichnungen wurden, ohne dass er gefragt oder dafür bezahlt wurde, in Massen zum Nachdruck verkauft. Auch erschienen viele Abbildungen von ihm, zu deren Reproduktion er keine Genehmigung erteilt hatte, die von den Verlegern gegen seinen Willen veröffentlicht worden waren. Zuerst hat er wohl manches ruhig geschehen lassen: »Man verliert sonst seine Beziehungen.« Dann hat er gemeinsam mit Kollegen Nachdruckskontrolle geübt, seine Zeit im Dienste der Kollegen geopfert. Jetzt steht er auf dem Standpunkt, von dem er erzählt:
»Der Kunsthändler .... bot mir so recht niedliche Preise für meine Zeichnungen. Am liebsten hätte er den ganzen Schwung so auf Ramsch gekauft. Da sagte ich zu ihm:
›Gewiss doch – ich werde meine Zeichnungen pfundweise verkaufen!‹
Da merkte er denn, was los war und ging. –«
*
Selbstbewusst erzählt er, wie Liebermann immer für ihn eintrat, wie er ihn in die Akademie brachte (siehe Kapitel: »Wenn man berühmt ist«) und wie er auch bei andern Gelegenheiten Zilles Können anerkannte und bewertete: Ein großer Verlag stiftete einen Preis für den besten Illustrationszeichner. Selbstverständlich wollte er – schon um der Reklame wegen – seinen Hauszeichner ausgezeichnet sehen. Aber Liebermann, der neben andern als Schiedsrichter gebeten war, bestimmte Zille als Preisträger. Das gab dann einen langen Streit und Verhandlungen zwischen Liebermann und dem Verlag.
Schließlich einigten sie sich auf Zille und den Hauszeichner.
Der Verlag stiftete eben zwei Preise ....
*
Zu einer berühmten Sängerin sagte Zille nach Schluss des Konzertes:
»Wie glücklich sind Siel Wenn Ihre Arbeit vorbei is, denn is se wech . . . Unsa Dreck bleibt immer!«
*
Einen bekannten, modernen Maler, der alles nach dem Modell zeichnet und malt, belehrte Zille:
»Sie müssen das ins Auge klemm'n un denn nachher zu Hause ausschütten. Wenn Sie das nich können, denn is 'ne Photographie besser.«
Überhaupt steht Zille der jüngsten Kunst – sehr kritisch gegenüber. So sagte er öfter:
»Die soll'n man erst so'n Stiebel malen, wie'n der Anton (Werner) jemalt hat!«
Diese Äußerung ist bezeichnend für seine Kunstauffassung. Ihm ist kein Gegenstand zu geringwertig. Er muss nur künstlerisch durchgearbeitet sein.
Er bleibt dabei, dass »Kunst« von »Können« kommt.
*
Auch von andern Eindrücken sprach Zille, von solchen aus der Kunst früherer Zeit. Er ließ manchen gelten, der eine Zeitlang übersehen worden war. Sprach achtungsvoll von Paul Meyerheim, vergaß nie Hosemann und erläuterte mit der Eindringlichkeit des Schaffenden die Unterschiede zwischen dem Pessimismus von Wilhelm Busch und seiner eigenen, aufbegehrenden, auf Besserung dringenden Weltanschauung.
Und wenn er gefragt wurde, ob das Volk ihm denn für das liebevolle Hinweisen auf seine Leiden und Nöte gedankt habe, fragte er mutwillig:
»Soll es mir verhauen? ... Nee – dazu is't nich gekommen. Aber so'n bißken Liebe merkt man doch, wenn man sich ums Volk kümmert –«
*
Mit gutem Humor sieht er auf sein früheres Leben zurück und lacht über Erlebnisse und Angriffe mannigfacher Art:
»Meine erste eigene Wohnung war im Osten Berlins im Keller; nun sitze ich schon im Berliner Westen, vier Treppen hoch, bin also auch ›gestiegen‹. Einige Radierungen sind ins Kupferstichkabinett gelangt und eine Anzahl Zeichnungen und Skizzen in die Nationalgalerie. Jetzt, 1924, bin ich sogar Mitglied der Akademie geworden. Dazu schreibe ich das, was das völkische Blatt, der ›Fridericus‹ sagt: ›Der Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner Heinrich Zille ist zum Mitglied der Akademie der Künste gewählt und als solcher vom Minister bestätigt worden. – Verhülle, o Muse, dein Haupt.«
Z.
*
Wenn er auch nicht mehr ganz so handelt, wie er im Motto seines Lebens und Schaffens angegeben hat – wenn er auch längst den Schluck in der Destille und das Kille-Kille abgeschworen hat: mit dem Ergebnis seiner frohen Arbeit kann er gewiss zufrieden sein.
Zwar zweifelt er manchmal und meint:
»Das kommt ja doch alles in den großen Müllkasten der Zeit!«
10. Verhülle, o Muse, dein Haupt!
Skizzenblatt, zum 1. Mal veröffentlicht.
Aber er hat auf seine Zeit gewirkt, hat beste Zeitkunst geschaffen, hat Augen und Herzen geöffnet. Und da er das mit wahrhaft klassischem Können und mit ernstestem Willen tat, wird er nicht im Müllkasten der Zeit verschwinden, sondern Zille, der Künstler unseres Volkes bleiben.
Zille in der Liebe des Volkes
Kein heutiger Künstler kann sich rühmen, so wie Zille vom Volke geliebt und gekannt zu sein. Das Volk hat, trotzdem er es in den humoristischen Zeichnungen für die Zeitschriften oft ein wenig komisch und von oben herab darstellen musste, immer seine große Liebe hindurch empfunden – und hat sie ihm auch reichlich vergolten. Er selbst konnte denn auch auf die Frage eines Schriftstellers erwidern:
»Ach ja – man merkt schon, dass man immer fürs Volk gearbeitet hat – so'n bißken Liebe merkt man schon. –«
Im weitesten und gemütvollsten Sinne des Wortes war Heinrich Zille eben ein Heimatskünstler. Nicht zum geringsten schmeichelte er sich in die Liebe des Volkes ein durch das Mitgefühl für die Kümmernisse und für die Freuden, das aus allen seinen Blättern sprach. Nicht zum wenigsten machte ihn beliebt die Darstellung der Berliner Kinder. (Siehe Kapitel: »Zille-Kinder« und die Kinderstudien im Abschnitt: »Studien und Akte«.) Wer Kinder sowie Zille ablauschen und durch seinen Zeichenstift festhalten kann, wird immer beim Volke die allerwärmste Gegenliebe erleben.
Er ging immer mit dem Zeichenstift in der Hand den Weg des Volkes. Nicht nur in die Kaschemmen und auf die Rummelplätze. Als um 1905 die sommerliche Auswanderung der Berliner in die Freibäder an den Spree- und Havelufern eine Wendung in der ganzen Lebensart der Hauptstädter brachte, ward Zille der Maler des Freibads. Aus einer Unzahl von Zeichnungen und Skizzen, in denen er die Lust der Berliner an Luft und Sonne betonte, sei hier wenigstens sein Blatt »Zurück zur Natur«, Bild 13, wiedergegeben. Auch in einigen andern Kapiteln (»Zille-Fräuleins« und »Zille-Witze«) sind mehrere Freibadbilder zu finden.
Читать дальше