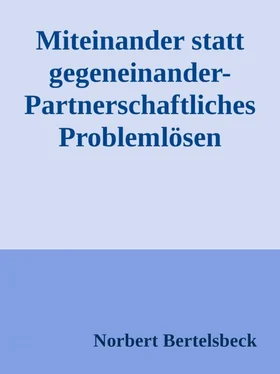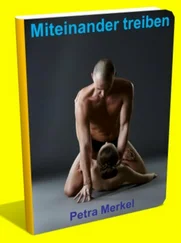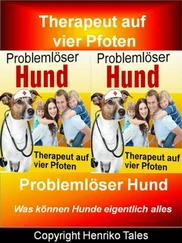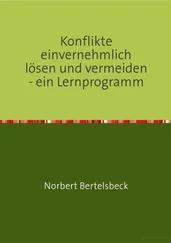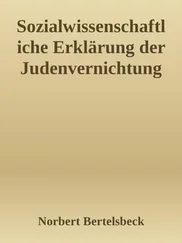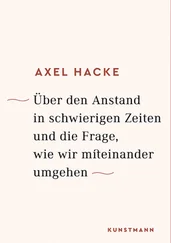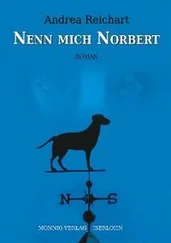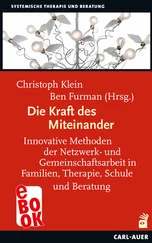- Echtheit/Kongruenz des Therapeuten
- Vollständiges und bedingungsloses Akzeptieren des Klienten und Wertschätzung ihm gegenüber
- Sensibles und präzise einfühlendes Verstehen des Klienten
Als Wirkungen derartiger Beratereinstellungen werden u. a. Selbstöffnung und Selbstauseinandersetzung des Klienten angeführt, die dazu führen, dass er besser mit sich und anderen leben kann (u. a. Tausch, „Gesprächspsychotherapie“). Im Rahmen des partnerschaftlichen Beziehungskonzepts soll u. a. Dritten dazu verholfen werden, ihre Probleme selbst zu lösen. Hierbei werden mit dem Passiven und Aktiven Zuhören Methoden genannt, die auf die Dimension Empathie der Gesprächspsychotherapie rekurrieren. Als primäre Methode wird dabei das Aktive Zuhören angesehen, das dem Ratsuchenden ermöglichen soll, tiefer in sein Problem einzudringen und eine eigenständige Problemlösung zu erreichen. Als eine weitere Voraussetzung für Hilfe wird genannt, dass der Berater den Ratsuchenden mit seinem Problem annimmt. Dies fördert die Selbstöffnung. Die „Annahme“ des Ratsuchenden mit seinem Problem entspricht der Dimension „Akzeptanz“ der Gesprächspsychotherapie. Im Rahmen des partnerschaftlichen Beziehungskonzepts wird eine falsche Annahme thematisiert (u. a. Gordon, „Familienkonferenz“, 2000, 33ff): Der Berater kann den Ratsuchenden mit seinem Problem nicht annehmen, signalisiert jedoch Annahme. Dieser Aspekt entspricht der Dimension (mangelnder) Echtheit von Rogers. Das partnerschaftliche Beziehungskonzept nimmt auf Ich-Botschaften Bezug, u. a. um das Eintreten eines erwünschten Verhaltens Dritter in der Zukunft sicherzustellen oder unerwünschtes Verhalten zu verändern. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass derartige Botschaften dem entsprechen sollen, was eine Person fühlt und denkt. Damit wird auf die o. a. Dimension Echtheit/Kongruenz Bezug genommen.
Das partnerschaftliche Beziehungskonzept
Themen
Zur Bestimmung der Themen eines partnerschaftlichen Beziehungskonzepts steht im Gordon-Modell ein Verhaltensrechteck zur Verfügung (u. a. Gordon, „Die neue Beziehungskonferenz“, 2002, 53ff; Adams, Lenz, „Beziehungskonferenz“, 2001,107ff). Dieses gibt zunächst die Sichtweise einer Person in Bezug auf das wahrgenommene Verhalten einer anderen Person wieder: Von den gesamten wahrgenommenen Verhaltensweisen wird ein Teil als annehmbar und ein anderer als unannehmbar bewertet. Annehmbar ist das Verhalten einer anderen Person, wenn es ein Bedürfnis oder einen Wert befriedigt, und unannehmbar, wenn es ein Bedürfnis oder einen Wert beeinträchtigt. Ob für eine Person ein bestimmtes Verhalten unannehmbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: der eigenen Persönlichkeit, momentanen Befindlichkeit, Situation und Art der Person, die das Verhalten zeigt (Adams, Lenz: „Beziehungskonferenz“, 2001, 110ff; Gordon: Familienkonferenz, 2000, 26ff).
- So kann das lärmende Verhalten eines Kindes von dem Vater und der Mutter unterschiedlich unangenehm erlebt werden (Personenunterschiede).
- Während die Mutter Lärm ggfs. normalerweise gut ertragen kann, ist dies nicht der Fall, wenn sie Kopfschmerzen hat (Befindlichkeitsunterschiede).
- Lärm kann die Mutter tolerieren, wenn sie mit dem Kind alleine zu Hause ist, jedoch nicht bei Besuch (Situationsunterschiede).
- Lärmt ein stilles Kind einmal, dann wird dies von der Mutter vielleicht positiv bewertet, jedoch bei einem lebhafteren Kind negativ (Persönlichkeitsunterschiede von Handelnden).
Da ein Verhalten also nicht per se als unannehmbar zu bewerten ist und nur im Falle der Unannehmbarkeit hierauf reagiert werden soll, resultiert daraus ein (gewünschtes) inkonsequentes Vorgehen bei Vorliegen eines bestimmten Verhaltens. Auf der Grundlage der vorgenommenen Unterscheidung von annehmbarem und unannehmbarem Verhalten einer anderen Person wird nun im Verhaltensrechteck eine weitere Dimension, d. h. die des Problembesitzes, eingeführt (Adams, Lenz: „Beziehungskonferenz“, 2001, 114ff):
- Dass du mir etwas Bestimmtes mitteilst, ist für mich annehmbar, drückt für dich jedoch ein Problem aus.
Beispiel:
Dass du als meine Partnerin von einer Nachbarin nicht mehr gegrüßt wirst und deshalb mit mir darüber reden willst, beeinträchtigt mich nicht in meinen Bedürfnissen.
- Das Verhalten von dir ist für mich annehmbar und stellt für dich selbst auch kein Problem dar. Wir befinden uns sozusagen in einer problemfreien Zone.
Beispiel:
Du als mein Arbeitskollege arbeitest an diesem Vormittag, ohne viel Worte zu wechseln, um eine Aufgabe zu beenden. Ich selbst habe auch eine Aufgabe zu erledigen und bin froh, nicht gestört zu werden
- Das Verhalten von dir ist für mich unannehmbar, und deshalb habe ich ein Problem.
Beispiel:
Du als mein Partner kommst spät abends nach Hause und stellst das Fernsehen laut an. Dadurch wache ich aus dem ersten Schlaf auf und kann erst einmal nicht weiterschlafen, obgleich ich früh aufstehen muss.
- Das Verhalten von dir ist für mich unannehmbar, so wie für dich das Verhalten von mir unannehmbar ist, so dass wir beide ein Problem haben.
Beispiel:
Du als meine Freundin möchtest im gemeinsamen Urlaub in die Berge, ich hingegen an die See.
Das Ziel, das mittels eines partnerschaftlichen Beziehungsverhaltens verfolgt wird, besteht nun darin,
- einerseits unannehmbares Verhalten einer anderen Person und Konflikte mit dieser zu verringern
- und andererseits dieser Person dabei behilflich zu sein, ihre eigenen Probleme zu lösen.
Insgesamt geht es so um die Vergrößerung der problemfreien Zone in verschiedenartigen Beziehungen. Wie dies zu bewerkstelligen ist, ist weiterer Gegenstand dieser Arbeit und beinhaltet das Aufzeigen von Problemlösungsmethoden für unterschiedliche Problemarten. Im Einzelnen werden die folgenden Themen behandelt:
- Was kann ich machen, wenn der andere ein Problem hat? Es wird eingegangen auf das Passive und Aktive Zuhören und auf die Aufgabe einer Moderation bei der Unterstützung einer eigenständigen Problemlösung.
Was kann ich machen, wenn mehrere Personen ein Problem miteinander haben? Im Gordon-Modell wird zusätzlich auch hierauf eingegangen. Da die Lösung solcher Konflikte u. a. auf der Niederlagelosen Methode der Konfliktlösung beruht, die später thematisiert wird, soll auch die Erläuterung der Konfliktvermittlung erst dann dargestellt werden.
- Im Bereich der problemfreien Zone zwischen dir und mir kommen unterschiedliche Ich-Botschaften zum Tragen, die einerseits Ausdruck einer konfliktfreien Beziehung sind, andererseits Problemen vorbeugen sollen.
- Für den Fall, dass eine Person ein Problem mit einer anderen hat als Folge einer Bedürfnisbeeinträchtigung, werden die Konfrontierende Ich-Botschaft und das Umschalten als geeignete Methoden des Umgangs mit dem Problem angesehen.
- Probleme mit anderen lassen sich ggfs. nicht mittels vorgenannter Ich-Botschaft und nachfolgendem Umschalten lösen. Es liegt dann ein Bedürfniskonflikt vor, der mittels der Niederlagelosen Methode der Konfliktlösung bearbeitet werden soll.
- Ein Konflikt mit einer anderen Person kann auch Folge einer Wertbeeinträchtigung sein. Zur Konfliktlösung stehen dann die Methoden der Niederlagelosen Methode der Konfliktlösung, Beratung und Konfrontierenden Ich-Botschaft bereit. Wertkonflikten kann vorgebeugt werden, indem ich ein Vorbild für andere darstelle oder meine Einstellung ändere.
Der andere hat ein Problem
Personen können unterschiedliche Ereignisse als Problem ansehen:
- So hat Ihr Ehepartner die Arbeitsstelle gewechselt und erlebt vieles als fremd.
- Der Vater Ihres Arbeitskollegen ist verstorben.
- Ihr Kind hat Streit mit seinem Spielgefährten.
Читать дальше