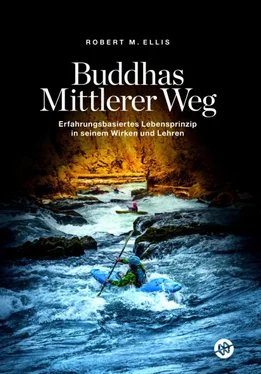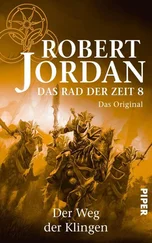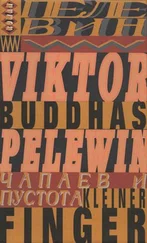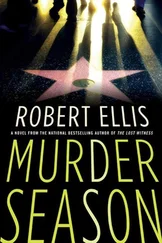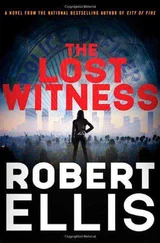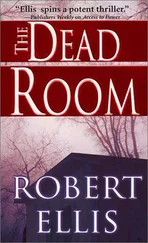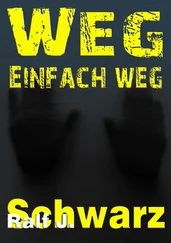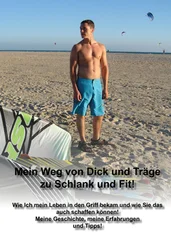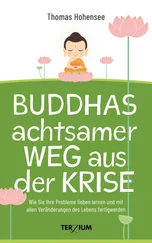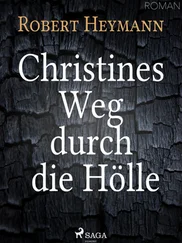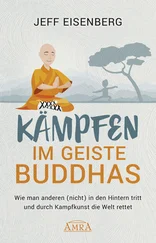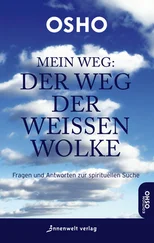„Prinz, man nennt ihn einen, der fortgegangen ist.“ „Warum nennt man ihn einen, der fortgegangen ist?“
„Prinz, mit einem, der fortgegangen ist, meinen wir einen, der wahrhaft dem Dhamma folgt, wahrhaft Gelassenheit lebt, gute Handlungen ausführt, verdienstvolle Taten vollbringt, harmlos ist und wahrhaft Mitgefühl für lebende Wesen hat.{10}
Es ist der bloße Unterschied zwischen dem Shramana und dem ihm zuvor Bekannten, der das Interesse des Prinzen weckt. Er sieht anders aus und sein andersartiges Aussehen deutet auf einen abweichenden Lebensstil mit abweichenden Annahmen hin. Im alten Indien dürfte dieser Unterschied weit mehr als nur eine andere Berufswahl gewesen sein, vielmehr ist es ein grundlegender Unterschied in Tradition und Kultur. Die Tradition, als hausloser Wanderer fortzugehen, wurde oft mit Urvölkern im alten Indien in Verbindung gebracht – denjenigen, die den dominanten Eindringlingen vorausgingen, von deren Nachkommen Siddhartha Gautama möglicherweise abstammt. Was auch immer die historische Erklärung für kulturelle Unterschiede zwischen Siddharthas Hintergrund und dem des Shramana sein mag, was zählt ist die erstaunliche Tiefe der kulturellen Kluft. Heute wäre möglicherweise die naheliegendste Analogie der Spross eines Mitglieds der sozioökonomischen Elite, der aus Oxford oder Harvard „aussteigt“ und sich einer Gemeinschaft schäbiger Landstreicher anschließt.
Neben der kulturellen Kluft gibt es jedoch auch eine Idealisierung der Shramanas. Was immer dieser Mann macht, er macht es „wahrhaft“. Er wird nicht als eine Person gesehen, die einen Entwicklungsprozess durchläuft, der darauf abzielt, besser und argloser zu sein, sondern einfach als eine absolute Verkörperung von Tugend und Mitgefühl. Die Idealisierung findet sich nicht nur in den Worten des Wagenlenkers, sondern auch in der Eilfertigkeit, mit der Siddhartha hierauf beschließt, denselben alternativen Lebensstil anzunehmen. Obwohl also der Shramana eine echte Alternative bietet, ist es eine idealisierte Alternative. Im Fortgang der Geschichte werden wir sehen, welche weiteren Beschränkungen durch diese Idealisierung entstehen und wie Siddhartha sie überwindet.
Während Siddhartha dieses alternative Leben wählt, indem er aus dem Palast in den Wald „fortgeht“, entwirft er bereits implizit die Vorstufen zur Auseinandersetzung mit dem Mittleren Weg. Er tut dies, obwohl der Mittlere Weg noch nicht explizit Teil seines Denkens ist. Denn der Mittlere Weg beginnt, wo auch immer wir anfangen, und er ist der hilfreichste Pfad, der vor uns liegt. Es mag unmöglich sein, direkt vom Erkennen der Begrenzungen einer Reihe von Annahmen zu einer ausgewogenen Position zu gelangen, in der wir auch die Begrenzungen des Gegenentwurfs sehen. Wir müssen uns von der ersten Palette absoluter Annahmen befreien, bevor wir die zweite mit gegensätzlichen überhaupt klar genug verstehen können. Um uns auf den Mittleren Weg einzulassen, müssen wir also vermutlich damit beginnen, vom anfänglichen Kontext mit all seinem Ballast absoluter Annahmen „fortzugehen“. Dabei ist es schwierig, die Alternative nicht zu idealisieren, weil alle Erwartungen auf ihr lasten.
In Ashvaghoshas erweiterter Fassung des „Fortgehens“ wird der Konflikt auf Grund absoluter Annahmen auf beiden Seiten durch einen zusätzlichen moralischen Konflikt betont. Es wird verdeutlicht, dass Siddhartha durch sein „Fortgehen“ seine Frau und seinen kleinen Sohn im Stich ließ sowie seine Eltern und zukünftige Pflichten. Siddharthas Wagenlenker, Chanda, erinnert ihn an diese sozialen Verantwortlichkeiten und versucht erfolglos, ihn davon abzuhalten, dem weltlichen Leben zu entsagen.{11} Dies bringt heutige Lesende, die sich voll und ganz mit Siddhartha als Helden identifizieren wollen, oft in moralische Konflikte, da er ein für viele heutige Lesende zentrales moralisches Tabu gebrochen hat. Die alten Inder mögen seine Familie zu verlassen, nachsichtiger beurteilt haben (vorausgesetzt, sie wurden von anderen Verwandten versorgt), vor allem, weil sie „Fortgehen“ demgegenüber idealisierten. Für heutige Lesende, die sich schwertun, den universellen, spirituellen Helden zu finden, den sie in solch einer präfeministischen Figur suchen – offensichtlich konsultiert er nicht einmal seine Frau, um ihre Unterstützung und Zustimmung zu erhalten, bevor er sie verlässt - dürfte dies jedoch ein schwacher Trost sein
Es gibt aber eine weitere Lesart des Fortgehens, die diesen Wunsch, Siddhartha zu idealisieren, loslässt. Bei dieser Lesart muss Siddhartha nicht perfekt sein und somit müssen wir seine Fehler nicht wegrationalisieren. Er findet Wege nach vorn, die unweigerlich verworren und unbefriedigend sind, und die Opfer vielerlei Art erfordern. Aber genau in der Verworrenheit dieses Prozesses liegt die Universalität des Mittleren Wegs. Siddhartha stellt in Frage, was er bisher für absolut hielt – die Werte des Palastes. Er hat sein ganzes Leben lang auf diese Werte gesetzt. Um sich von der absoluten Macht dieser Werte zu befreien, muss er das Extrem der Loslösung wählen. Vielleicht können wir uns andere mögliche Wege vorstellen, die er hätte einschlagen können, die kompromissorientierter gewesen wären. Wäre es so schwierig gewesen, vorerst im Palst zu bleiben, während er Alternativen kennenlernt und sogar seine Macht im Palast nutzt, um schrittweise seine Werte zu verändern? Aber wahrscheinlich hätte Siddhartha dies nicht praktisch umsetzen können. Stattdessen würde seine psychische Gewöhnung an die Werte des Palastes ihn weiterhin beherrschen. Nur durch seine Flucht und zunächst, indem er das Extrem gegensätzlicher Werte ausprobiert, kann er verhindern, in die alles verzehrende, absolute Umgebung, die ihn umgibt, hineingezogen zu werden. Um wegzukommen, muss er Opfer bringen, selbst solche, die sich auf andere auswirken, und es kann sich durchaus als Fehler erweisen oder als etwas, das man später bereut. Alles, was wir also tun können, ist zu versuchen, die Gesamtheit der Bedingungen zum Zeitpunkt unseres Urteils zu berücksichtigen. Wenn wir nur einer starren moralischen oder sonstigen Regel folgen, könnten wir wichtige Bedingungen außer Acht lassen.
Ein universeller Wert, den die Vier Zeichen vermitteln, ist Vorläufigkeit. Wenn unsere Urteile nur vorläufig sind, können wir eine kritische Sichtweise auf unsere gewohnheitsmäßigen Annahmen einnehmen (wie durch die Drei Erkenntnisse verdeutlicht). Entscheidend ist jedoch, dass wir auch neue Alternativen erkennen und in Betracht ziehen können (wie durch das Vierte Zeichen verdeutlicht).
Indem Siddhartha über einen verabsolutierenden Kontext hinausgeht, in dem er gezwungen wäre, in der alten Weise zu denken, schließt sein „Fortgehen“ auch den ersten Schritt anderer grundlegender Prinzipien ein, die ich (im weiteren Verlauf) als Aspekte des Mittleren Wegs erörtern werde. Dazu gehört Skepsis, mit der wir unseren fehlbaren, menschlichen Status anerkennen und so die Gewissheiten in Frage stellen, die wir nur übernommen haben, weil wir diese Fehlbarkeit in der Vergangenheit ignoriert haben. Dazu gehört auch die Integration, die eigentliche Konfliktbewältigung, indem wir über festgefahrene Positionen hinausgehen, entweder bei uns oder anderen. Fest verwurzelte Spaltungen zu beseitigen ist relativ einfach, wenn wir bereits zivilisierte Bedingungen für Dialog und Reflexion geschaffen haben. Es ist sehr viel schwieriger, wenn wir durch die Macht einer Gruppe gefangen sind, die enormen Druck auf uns ausübt, damit wir weiterhin in einer bestimmten absoluten Weise, in Übereinstimmung mit ihren Werten denken. Der erste Schritt zur Integration muss darin bestehen, uns von den Werten dieser Gruppe so weit zu trennen, dass ein breiteres Bewusstsein entstehen kann. In dieser Phase hat Siddhartha sowohl in Hinblick auf seine Skepsis als auch auf seine Integration noch Wegstrecke vor sich, aber er beginnt, sie implizit zu erkennen und anzuwenden.
Читать дальше