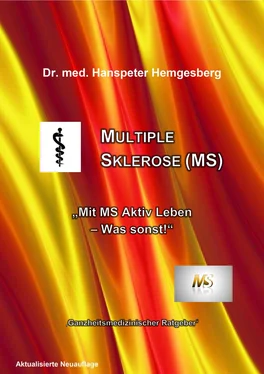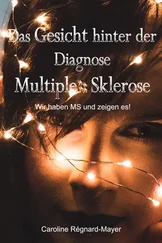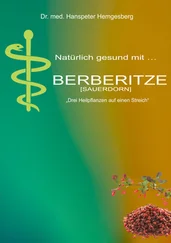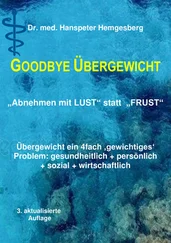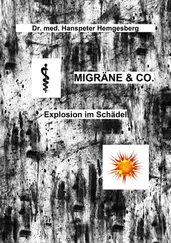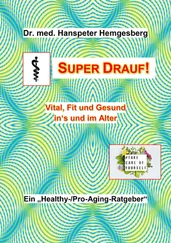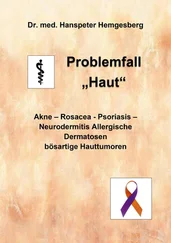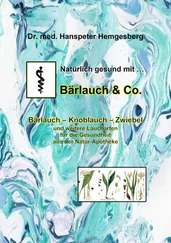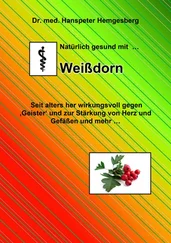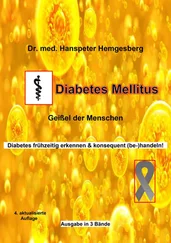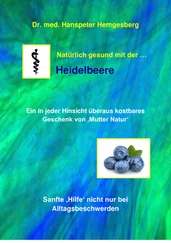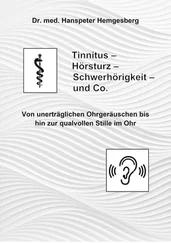Die Wissenschaftler haben dazu das Genom von 1800 MS-Patienten analysiert. Etwa 40 Prozent des Human-Genoms wurde nach solchen Genen untersucht, bis Ende April 2003 waren 95% entschlüsselt. Die Wissenschaftler erhoffen sich durch die Erkenntnisse eine bessere Entwicklung neuer MS-Therapeutika.
[Meldung der „Ärzte-Zeitung“, Neu-Isenburg (eb)]
Zwei Risiko-Gene für MS entdeckt
US-Wissenschaftlern in Boston sind bestimmten Gen-Varianten auf die Spur gekommen, die die Gefahr für Multiple Sklerose deutlich steigern. Im Rahmen eines groß-angelegten Gen-Screenings stießen sie dabei auf die Gene „Il-7R“ (Interleukin-7-Rezeptor) und „Il-2R“ (Interleukijn-2-Rezeptor), die als Bauvorlage für Interleukin-7 und -2 dienen.
Bestimmte Varianten dieser beiden Gene erhöhen den Studienergebnissen gemäß das Risiko für MS um jeweils 20-30%.
[Meldung NEJM Online – 08/2007]
Toll-Like-Rezeptoren [TLR]
Bei den TLR () handelt es sich um klassische Erkennungs-Rezeptoren auf vielen Zellen für Viren und Bakterien. Auf diese Weise wappnen sich z.B. Blutzellen gegen Infektionskrankheiten.
Seit längerer Zeit ist bekannt, dass TLRs beteiligt sind, wenn durch Infektionen neue MS-Schübe ausgelöst werden. Offenbar aber spielen die TLRs jedoch direkt im Gehirn auch dann eine wichtige Rolle bei MS, wenn keine Infektionen vorliegen! TLR spielen eine entscheidende Rolle in der Erkennung und Bekämpfung von in den Körper eindringenden Mikro-Organismen. Seit Kurzem ist bekannt, dass Mastzellen (), die selber im Rahmen der angeborenen Immunität eine wichtige Rolle in der Bekämpfung bakterieller Infektionen spielen, TLR exprimieren.
Die TLRs müssen bei der MS im Gehirn alternative Bindungspartner besitzen.
Diese könn(t)en bei der MS – wie auch bei sonstigen Auto-Immunerkrankungen – entweder neu gebildet oder durch die Erkrankung selbst entscheidend verändert werden.
Heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass diese TLRs eine weitaus wichtigere Rolle bei der MS spielen, als bisher angenommen!
Diese (Er-)Kenntnis könnte sich als Ansatzpunkt für neue Behandlungs-Strategien erweisen.
[Quelle: PD Dr. Marco Prinz, Uni Göttingen, in: „Befund MS“ - Ausgabe 1/2006]
Entdeckung krankmachender Autoantikörper bei MS
Die Arbeitsgruppe von Prof. B. Hemmer (damals Uni Düsseldorf, heute Techn. Universität/TU München) um Dr. Dun Zhou (publiziert in der Fachzeitschrift PNAS [Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]) konnte erstmals potenziell krank-machende Autoantikörper identifizieren, die in Zusammenhang mit MS stehen könnten.
Das Immun-System der Betroffenen erkennt fälschlicherweise körper-eigene Strukturen als „Feind“ und reagiert mit Abwehr. Dieses Erkennen erfolgt durch bestimmte Zellen des Immun-Systems, die sogen. T- und B-Lymphozyten (T- und B-Zellen). Letztere produzieren Antikörper (AK). Diese AK bewirken eine Schädigung der Isolierschicht der Nervenkabel, der Mark- oder Myelinscheide.
Die T- oder B-Lymphozyten erkennen das vermutliche Autoantigen „MOG“ (Myelin-Olidodendrozyten-Glycoprotein) () in der Form, in der es sich auf der Oberfläche von Hinzellen dem Immun-System präsentiert.
Ziel weiterer und nachgehender Bemühungen und Forschungen ist es nunmehr, nach neuen Immun-Therapien zur effektiveren Behandlung der MS zu fahnden, welche speziell gegen Autoantikörperproduzierenden B-Lymphozyten gerichtet sind.
[Quelle: Prof. Dr. B. Hemmer, Technische Uni München, Klinikum rechts der Isar – PNAS]
Dendritische Zellen [DC]() = „Verräterzellen“
Durch die Krankheit MS greift das Immunsystem Strukturen im Gehirn – wie einen Fremdkörper – an und verursacht so schwere Schäden.
Es ist gelungen, bislang unbekannte „Verräterzellen“ , die „Dendritischen Zellen“ , in der Blut-Hirn-Schranke nachzuweisen und zu identifizieren.
Diese Zellen weisen den autoaggressiven Immunzellen den Weg zu den Strukturen im Gehirn.
Als gesichert darf heute gelten, dass diese DC für die Krankheits-Entstehung bei MS absolut erforderlich sind.
DC sind Zellen des Immun-Systems. Sie sind nach ihren typischen Bäumchen-artigen Zytoplasma-Ausläufern (lat. dendriticus = verzweigt) benannt. DC haben eine wichtige Funktion bei der Antigenprozessierungund Antigenpräsentation. Über Toll-artige (TOLL-like) Rezeptorenerkennen sie Keim-Strukturen und können so die zelluläre Immunantwort steuern.
Durch Ausschüttung entsprechender Zytokineund Expression bestimmter Zelloberflächen-Rezeptoren beeinflussen sie die T-Zellen hin zu einer TH1- oder TH2-Antwort (TH = T-Helfer-Zelle) oder können z.B. auto-reaktive T-Zellen in die Anergietreiben.
Fakt ist:
Ohne diese Verräterzellen können die Täterzellen des Immunsystems ihr Opfer(gewebe) in Gehirn und/oder Rückenmark nicht erkennen!
Daraus folgert sich:
Ziel muss es nunmehr sein, die Verräterzellen durch entsprechende Interventionen so zu manipulieren, dass das irregeleitete Immunsystem das Gehirn/Rückenmark dann und für immer ignoriert!
Nebenbei:
Diese neuen Erkenntnisse haben dann auch Auswirkungen auf die Erforschung und Behandlung anderer Gehirn-Erkrankungen wie z.B. Alzheimer-Demenz bzw. sonstiger Demenz-Formen und Hirntumoren.
[Quelle: Prof. Burkhard Becher, Uni Zürich, in: „Befund MS“ - Ausgabe 1/2006]
Mineralstoffe bei der MS
Ein möglicher Zusammenhang könnte bestehen zwischen erhöhten Aluminium-Urin-Ausscheidungswerten und MS.
Besonders hoch (bis zum 40fach überhöhten Wert) fanden sich die Werte bei MS-Kranken mit schubfömig-remittierender Verlaufsform.
Erhöht findet sich die Eisen-Urin-Ausscheidung ; besonders stark bei der sekundär-progressiven Verlaufsform .
Hingegen war Silizium (Kieselsäure) in der Urinausscheidung vermindert; besonders bei Patienten mit sekundär-progressiver Form.
[Quelle: news ticker in: „Befund MS“ - Ausgabe 1/2006]
Lassen Sie mich zusammenfassen und gleichzeitig ergänzen, i.S.e. Versuches, die pathogenetisch bedeutenden/relevanten Ereignisse auf eine knappe Formel zu bringen:
Es gibt unterschiedliche Hypothesen, die versuchen, die histo- und immuno-pathologischen Befunde zu einem einheitlichen Bild zusammenzufügen. Ein mögliches Modell der Pathogenese der MS stellt sich wie folgt dar:
In der Peripherie werden autoreaktive T-Helferzellen aktiviert. Vorstellbare Mechanismen dafür sind die Quervernetzung von T-Zellrezeptoren und MHC-Molekülen durch Superantigene, Kreuz-Reaktivität mit anderen Antigenen/AG () oder ein verändertes Zytokin-Milieu.
Aktivierte Lymphozyten können dann die Blut-Hirn-Schranke () passieren und durch Auto-Antigene reaktiviert werden.
Es wird angenommen, dass die nachfolgende Entzündungsreaktion für die Demyelinisierung zentraler Axone und die Axondegeneration verantwortlich ist.
Humanes Myelin Basic Protein (hMBP)
als mögliches Auto-Antigen
hMBP () ist mit ca. 30% des Myelin-Trockengewichts die Haupt-Komponente der Markscheiden im menschlichen ZNS.
Neben drei splicing-Varianten sind strukturell verwandte Iso-Formen bekannt, die auch außerhalb des ZNS, vorwiegend in Thymus und Lymphgewebe, exprimiert werden ( Zelenika et al., 1993).
hMBP ist das am meisten untersuchte potenzielle Auto-Antigen bei der MS. Neben der Erforschung der pathogenetischen Relevanz dieses potenziellen Auto-Antigens/AAG () gibt es mehrere Ansätze zur therapeutischen Anwendung MBP-verwandter Peptide oder Proteine ().
Das ursprünglich zur Induktion der EAE [= Experimentelle Allergische Enzephalomyelitis] entwickelte polymere MBP-Analogon Copolymer I () zeigte eine unerwartete protektive Wirkung und wird heute als MS-Rezidiv-Prophylaxe eingesetzt ( Gran et al., 2000, Neuhaus et al., 2001).
Читать дальше