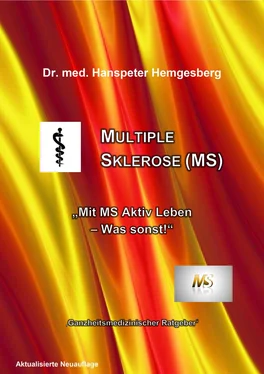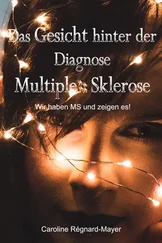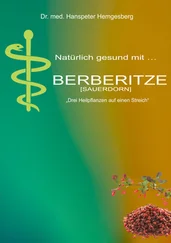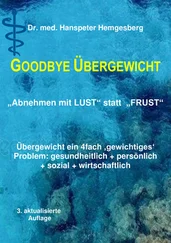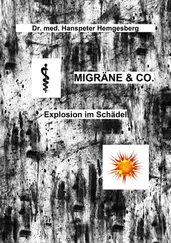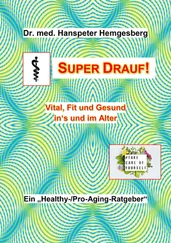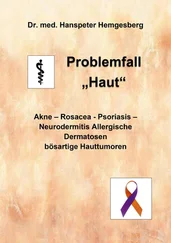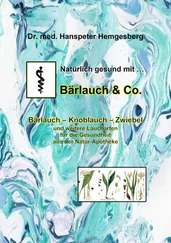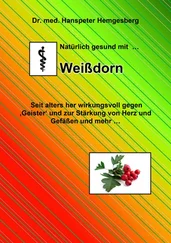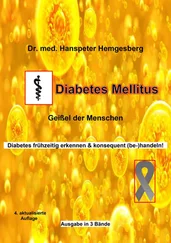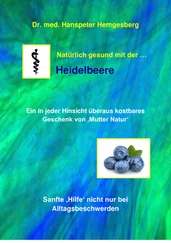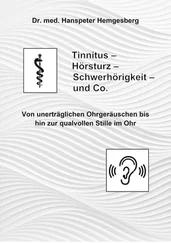Daneben wurden klinische Studien zur Wirksamkeit von sogen. „altered peptide ligands/APL“ durchgeführt ( Kappos et al., 2000; Bielekova et al., 2000).
Diese synthetisch hergestellten Peptide unterscheiden sich durch wenige Aminosäure-Substitutionen von einem als immun-dominant beschriebenen MBP-Peptid. Es wird intensiv diskutiert, dass sie die Aktivierung MBP-spezifischer T-Helferzellen modulieren.
Beide Studien wurden jedoch abgebrochen – die eine wegen auftretenden Hypersensibilitätsreaktionen, die andere, weil einige Patienten eine erhöhte Schubfrequenz aufwiesen.
Bibiana Bielekova (Prof. Dr. – wissenschaftliche Hauptermittlerin in der MS-Forschung an der Abteilung für neuro-immunologische Krankheiten am National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIAI, Bethesda, Montgomery County US-Staat Maryland – langfristiges Ziel der Forschungen ist es, die Mechnismen zu verstehen, die an Verletzungen des Zentralnervensystems/ZNS beteiligt sind, und diejenigen, und auch diejenigen, die neuroprotektive Funktionen haben, um wirksame Therapien für neuro-immunologische Erkrankungen, insbesondere Multiple Sklerose (MS), zu entwickeln) et al. zeigten bei einem Teil dieser Patienten mit häufigeren Schüben eine Expansion pro-inflammatorischer T-Helferzellen, die spezifisch für die „altered peptide ligands“ und MBP waren.
Dies ist ein Hinweis auf die pathogenetische Relevanz MBP-spezifischer T-Zellen.
Daneben zeigen diese Studien, dass die Wirkmechanismen der „altered peptide ligands“ bei weitem nicht vollständig verstanden sind.
Eine wichtige Frage:
Unterscheiden sich MBP-spezifische T-Helferzellen von MS-Patienten und Gesunden?
MBP-spezifische T-Helferzellen sind Bestandteil des T-Zell-Repertoires sowohl von MS-Patienten als auch von Gesunden.
Es stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Immunantwort bezüglich der Frequenz, des Phänotyps [Der Phänotyp oder das Erscheinungsbild ist in der Genetik die Menge aller Merkmale eines Organismus. Er bezieht sich nicht nur auf morphologische, sondern auch auf physiologische Eigenschaften und ggfls. auf Verhaltensmerkmale. Der Phänotyp wird durch das Zusammenwirken von Erbanlagen und Umweltfaktoren bestimmt] oder des Aktivierungsstatus unterscheidet.
Mehrere Studien haben die relativen Häufigkeiten (Frequenzen) MBP-spezifischer T-Helferzellen ermittelt. Einige konnten erhöhte Häufigkeiten bei MS-Patienten nachweisen ( Chou et al., 1992; Lodge et al., 1996), während sich die Frequenzen in anderen Studien nicht signifikant unterschieden ( Zhang et al., 1992; Tejada-Simon et al., 2001).
Es weisen mehrere Ergebnisse darauf hin, dass MBP-spezifische T-Helferzellen bei MS-Patienten im Gegensatz zu Gesunden bereits aktiviert wurden und klonal expandiert sind: Allegretta et al. untersuchten 1990 die Mutations-Häufigkeit eines Marker-Gen‘s bei MBP-spezifischen T-Zelllinien von MS-Patienten und Gesunden und fanden vermehrt Mutationen bei Linien von Patienten.
Geht man davon aus, dass bei häufigerer Zellteilung vermehrt Zufalls-Mutationen auftreten, ist dies ein Hinweis auf eine klonale Expansion bei MS-Patienten.
Die Aktivierung MBP-spezifischer T-Zellen von MS-Patienten scheint weniger abhängig vom co-stimultorischen CD28/B7-Signal (CD28 = T-Zelloberflächenproten // B7 = ein Protein, das zur Immunglobulin-Superfamilie gehört. Es ist als co-stimulatorischesMolekül auf antigenpräsentierenden Zellenlokalisiert, welche wichtig für die T-Zell-Aktivierungsind) zu sein als die Aktivierung anderer antigen-spezifischer T-Helferzellen ( Lovett-Racke et al., 1997; Scholz et al., 1998).
Zang et al. zeigten 1999, dass MBP-reaktive, Apoptose-sensitive Zellen bei MS-Patienten persistieren. Dies könnte bedeuten, dass sie der peripheren Toleranz entgehen.
Die Frage, ob MBP-spezifische T-Helferzellen im peripheren Blut vorwiegend naive Zellen oder Gedächtniszellen sind, wird kontrovers diskutiert:
Es gibt Arbeiten, die die Zugehörigkeit dieser Zellen zum Gedächtnispool, d.h. der CD45RO-exprimierenden Zellen, zeigten ( Bielekova et al., 1999; Burns et al., 1999), während eine andere Gruppe die Herkunft MBP-spezifischer T-Zelllinien vorwiegend aus CD45RA+ naiven Zellen zeigte ( Muraro et al., 2000).
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es Hinweise auf eine Aktivierung MBP-spezifischer T-Helferzellen bei MS-Patienten gibt, was für deren pathogenetische Relevanz spricht.
Alle diese Erkenntnisse wurden jedoch aus Experimenten an MBP-spezifischen T-Zell-Linien oder -Klonen gewonnen. Durch die lange Kultivierung sind daraus nur eingeschränkt Rückschlüsse auf Verhältnisse möglich. Es bleibt also zu zeigen, inwieweit diese Ergebnisse durch Untersuchungen bestätigt werden können.
Es gibt Hinweise auf ein Überwiegen pro-inflammatorischer MBP-spezifischer CD4+-Zellen [Der CD4-Rezeptor, kurz CD4, ist ein auf der Oberfläche von Monozyten, Makrophagenund T-Helferzellenexprimiertes Glykoprotein. Er erkennt zusammen mit dem T-Zell-Rezeptor(TCR) als Co-Rezeptordie von Körperzellen exprimierten MHC-Klasse-II-Komplexe].
Das Zytokin-Profil MBP-spezifischer CD4+-Zellen ist heterogen, es zeigt sich jedoch eine Tendenz in Richtung pro-inflammatorischer Zytokine ( Vandevyver et al., 1998).
In einigen Studien konnte auch eine verstärkte TH1-Zytokin-Sekretion bei MS-Patienten im Vergleich zu Gesunden nachgewiesen werden ( Tejada-Simon et al., 2001; Rohowsky-Kochan et al., 2000).
Soviel und soweit zu (weitgehend) gesicherten Fakten.
Hinsichtlich der nachfolgend zu skizzierenden „Pathologien“ gibt es bislang Mutmaßungen und auch erste Untersuchungen und zwar zur „Blut-Hirn-Schranke“ (), der „Funktionstüchtigkeit der Mitochondrien“ (), der „Hormonellen Stress-Achse“ () und zu „Gehirnstoffwechsel und Gehirnfunktionen“.
Offen ist dabei, ob bei MS-Kranken primär eine Störung vorgelegen war/ist – die dann letztlich (mit-)verantwortlich ist/sein könnte für das Manifestieren der MS – oder, ob es infolge der MS – also sekundär – zu den Schädigungen kommt.
Blut-Hirn-Schranke ()
Die Blut-Hirn-Schranke/BHS ist eine selektiv durchlässige Schranke zwischen Hirn-Substanz und Blutstrom, die den Stoff-Austausch im ZNSkontrolliert. Stoffe, die nicht in das ZNSgelangen sollen, werden am Durchtritt durch die Kapillarwand gehindert. Diese Barriere besteht aus 3 Schichten [von innen nach außen: Kapillarendothel, Basalmembran, Fortsätze der Astrozyten].
Die Wirkung:
Fettlösliche Substanzen wie Nikotin, Alkohol und Blutgase, ferner Narkotika diffundieren durch diese Barriere hindurch und gelangen so in das Gehirn! Die übrigen Substanzen sind hingegen auf spezifische ‚Transportsysteme’ (Carrier) angewiesen. Das gilt für pathogene Erreger (Bakterien, Viren) wie für Stoffwechsel-Endprodukte (Stoffwechselschlacken und Stoffwechselgifte wie u.a. Ammoniak als potentes ‚Zellgift’); Toxine und auch für Botenstoffe.
Die Aufgabe:
Weitgehende Konstanterhaltung der chemischen Zusammensetzung der Flüssigkeiten in den Gehirnzellen!
Bereits in sehr frühen Stadien (oder bereits vor der MS-Manifestation?) wird diese wichtige Barriere zwischen der Blutbahn und dem ZNS geschädigt.
Die Entzündungsreaktionen, die bei der MS ablaufen, machen diese Schranke durchlässig.
Diese dünne Trennwand verhindert normalerweise, dass z.B. pathogene Keime und/oder Fremdkörper und/oder toxische Substanzen (wie Alkohol, Drogen, Nikotin, Arzneistoffe, Toxine) ins Nerven-System eindringen können und dort Schäden verursachen können. Durch die geschädigte Membran können bestimmte Zellen des Immun-Systems (aktivierte Abwehrzellen und aggressive, zerstörerische T-Zellen) in großer Zahl aus den Blutgefäßen ins Nervensystem einwandern. Die eingedrungenen T-Zellen (T-Lymphozyten ()) haben nur ein bestimmtes Ziel:
Читать дальше