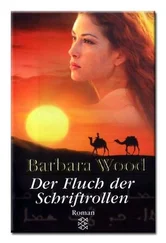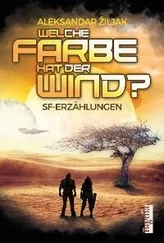„Indianer!“
Plötzlich wurde es unruhig und Panik brach aus. Immer wieder schrie der Treckführer das Wort, als er an allen Wagen im scharfen Galopp vorbei preschte. Die vorderen Wagen fuhren nun schneller und der Treckführer kam im wilden Galopp zurück und befahl Ihnen eine Wagenburg zu bauen.
„Oh mein Gott, Robert! Indianer! Was sollen wir tun?“
„Geht beide nach hinten und legt euch flach auf den Boden. In der einen Kiste sind meine Patronen, hol sie mir und dann geht in Deckung.“
Schnell kletterte Moira mit ihrem Sohn ins Innere des Wagens. Durch die hintere Öffnung konnte sie sehen, das alle Wagen hinter ihr versuchten, mit ihrer Geschwindigkeit mitzuhalten.
Sie drückte ihren Sohn auf den Boden und gab ihm ein Zeichen dort zu bleiben. Schnell suchte sie in der Kiste die Packung mit den Patronen und reichte sie ihrem Mann nach vorne. Dann legte sie sich dicht neben ihren Sohn auf den Boden. Durch das Tempo der galoppierenden Pferde wurde der Wagen hart durchgeschüttelt. Von draußen konnte sie jetzt das Kriegsgeschrei von näher kommenden Indianern hören. Die Angst stieg in ihr hoch. Ganz unbewusst zog sie ihren Sohn stärker zu sich ran. Wieder hörte sie den Treckführer Kommandos brüllen und merkte sofort, wie der Wagen im Kreis fuhr.
Alle Wagen schafften es gerade noch rechtzeitig einen Kreis zu bilden, den sie so eng hielten, dass zwischen den einzelnen Wagen niemand durchkam. Dann brach der Tumult los. Eine riesige Horde von Sioux Indianern griff die Wagenburg an. Mit großem Gebrüll galoppierten sie um die Wagenburg herum. Schnell brachten sich die Menschen des Trecks in Sicherheit. Kinder und Frauen wurden in die Wagen geschickt, während die Männer sich bewaffnet unter die Wagen legten und auf das Kommando zum Angriff warteten. Dieses ließ nicht lange auf sich warten. Als der erste Pfeil der Indianer die Wagenburg traf, gab der Führer den Befehl zum Schießen.
Der ersten Gewehrfeuer Salve folgte sogleich ein Pfeilregen der Indianer. Nach den ersten Verlusten aufseiten der Indianer änderten diese Ihre Taktik und schossen nun Brandpfeile auf die Wagen, die sofort Feuer fingen. Frauen und Kinder darin drangen nach draußen um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen, wo sie von den Pfeilen der Indianer in Empfang genommen wurden.
Die entsetzten Männer schossen, was die Gewehre hergaben. Die Mittagssonne schien auf ein Bild des Grauens nieder. Schüsse und Todesschreie wollten nicht enden. Moira kramte aus einer Tasche einen kleinen Beutel hervor und gab diesen ihrem kleinen Jungen. Darin befand sich ein kleines Amulett, welches Sie von Robert zur Hochzeit bekommen hatte. In diesem Amulett waren die Bilder von ihr und von Robert. Weiterhin waren dort noch eine Fotografie, die sie alle drei zusammen zeigte und der kleine Teddybär, den schon Robert von seiner Mutter bekommen hatte. Sie hängte den Beutel ihrem Sohn um den Hals.
„Pass gut darauf auf. Sollte uns etwas passieren, geh zu Großmutter, hörst Du? Ich bete zu Gott, dass wir das hier überleben.“
Moira versuchte die Tränen, die in ihr aufstiegen zu verdrängen. Ihr kleiner Sohn brauchte ihre Stärke. Verängstigt kroch er näher an seine Mutter heran. Noch war sie auf dem Fußboden in ihrem Wagen und sie hörte von draußen die Schreie der Menschen, die von Pfeilen getroffen waren. Plötzlich fing auch ihr Wagen an zu brennen. Wenn sie nicht bei lebendigem Leibe verbrennen wollten, musste sie aus dem Wagen raus.
Schnell aber vorsichtig robbten beide zum Ausgang. Sie schrie nach Robert, der darauf sofort aus seiner Deckung kam und seinen Sohn zu sich runter riss. Er gab ihm den Wink sich unter dem Wagen flach auf den Bauch zu legen. Gerade als Robert seiner Frau aus dem Wagen helfen wollte, flog ein Pfeil in seine Richtung und er konnte gerade noch in Deckung gehen, bevor er sich vor ihm ins Holz bohrte.
Sofort legte er sein Gewehr an und zielte auf den nächsten Indianer, der an ihm vorbei galoppierte. Er drückte ab und sah, wie der Sioux vom Pferd flog. Diese Sekunde genügte ihm, um seine Frau ebenfalls vom Wagen zu heben. Doch gerade, als sie unter den Wagen kriechen wollte, traf, sie ein Pfeil mitten ins Herz. Sie brach vor den Augen ihres Sohnes tot zusammen.
„Neeiin!“, schrie Robert vor Entsetzen. In seinem Schmerz dachte er nicht mehr an seinen Sohn und nahm das Gewehr, feuerte, ohne selber in Deckung zu gehen, auf die wilden Indianer. Drei von ihnen nahm er noch mit, bevor er selbst von einem Pfeil im Rücken getroffen tot zusammenbrach. Der kleine MacIntyre saß zitternd vor Angst, zusammengekauert unter dem Wagen seiner toten Eltern. Er vergrub weinend und schluchzend das Gesicht zwischen seinen Knien und verschloss die Ohren mit seinen Händen. Den letzten Todeskampf der anderen Mitreisenden bekam er nur vage mit. Der Siegesschrei der Indianer übertönte alles andere.
Mit einem Mal war es still. Keine Schüsse fielen mehr, kein Geschrei war mehr zu hören. Nur ein kleines Wimmern drang von irgendwo her. Sollte er sich trauen, unter dem Wagen hervor zu kommen oder sollte er lieber dort bleiben. Er verhielt sich mucksmäuschenstill und traute sich nicht einmal Luft zu holen. Wie lange er da so still gesessen hatte, wusste er nicht. Gerade als er aufatmen wollte, griff eine Hand nach seinem Arm und zog ihn mit Gebrüll unter dem Wagen hervor. Entsetzt schrie er auf und schaute in das kriegsbemalte Gesicht des Sioux Indianers, bevor er die kalte Klinge seines Messers an seinem Hals spürte.
Wyoming 1877
Über der Prärie lag noch die Stille der Nacht, doch am Horizont konnte man schon die ersten Anzeichen des neuen Tages erblicken. Langsam wich die Dunkelheit dem tiefen Orange der aufgehenden Sonne. Die Nacht war sternenklar gewesen, doch nun verblassten die kleinen Glitzerpunkte schnell am Himmel. Der harte Winter war vorbei, doch noch immer herrschte ein eisiger Wind, der über die endlose Weite fegte. Die aufgehende Sonne würde bald die ersten warmen Strahlen bringen, die die Prärie aufblühen lassen würde und in eine grüne mit Wildblumen übersäte Landschaft verändern würde.
Wenn man die Augen offen hielt, konnte man überall die Vorboten des Frühlings entdecken. Kleine zarte Knospen an den Bäumen, ein erstes zaghaftes Grün auf der Erde und auch die Tierwelt rappelte sich aus dem Winterschlaf auf. In der Luft roch es nach mehreren gut geschürten Lagerfeuern. Um sie herum standen die Zelte der Cheyenne. Bis auf ein paar Krieger, die dick eingehüllt in Decken ums Feuer saßen und Wache hielten, war es noch still im Lager. Pferde grasten ruhig in der Nähe. Es würde nicht mehr lange dauern, bis es taghell wäre und das Leben in den Zelten erwachen würde.
Die beiden Männer, die das Geschehen im Dorf von einer Anhöhe beobachteten, saßen schweigsam auf ihren Pferden. Beide trugen lange braune Wildlederhosen mit Fransen an den Außennähten. Dazu passend ein mit bunten Perlen besticktes, langärmeliges Wildlederhemd.
Ihre Füße steckten in mit Büffelfell gefütterten Moccasins. Um sich vor der Kälte zu schützen, hatten sie sich Decken, die mit reichlichen indianischen Mustern bestickt waren, um die Schultern gelegt. Die langen schwarzen Haare waren zu je zwei Zöpfen geflochten, die ein kleines Lederband zusammenhielt. Um die Stirn herum trugen sie ein einfaches Band aus Schlangenleder, in dem am Hinterkopf eine Adlerfeder steckte.
Vollkommen ruhig standen Mensch und Tier auf der Anhöhe und nur der heiße Atem aus den Nüstern der Pferde, der in der kalten Luft zu erkennen war verriet, dass es sich hier um lebende Wesen handelte und nicht um Statuen.
„Mein Bruder weiß, dass er nicht gehen muss!“
Ohne seinen Blick vom Dorf abzuwenden, hatte er seinen Freund angesprochen. Dieser schwieg, lange bevor er endlich antwortete:
„Ich weiß, aber es ist besser so.“
Читать дальше