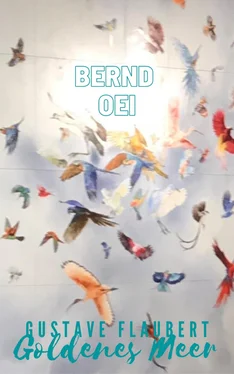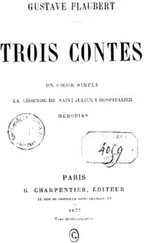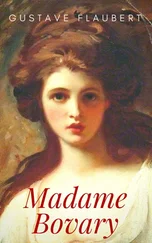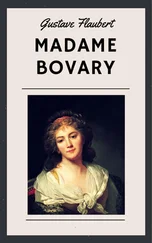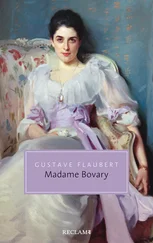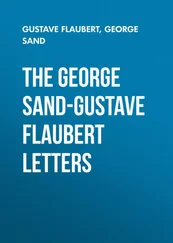Eines Morgens wacht er auf und weiß, was zu tun ist. Der Westen ist müde, verlebt, grau geworden, er muss an die Quelle der Sonne, der muss in den Orient. „ Es gibt Dichter, deren Seele ganz voll von Düften und Blumen ist, andere, die nur Düsteres haben, nur Bitterkeit und Wut. Jeder von uns hat ein Prisma, durch das er die irdische Welt wahrnimmt.“
Tagelang sieht er den einst frischen Rosen beim Welken zu, wie sie das Unvermeidliche hinnehmen, klaglos, wie es scheint. Neben ihm liegt ein fast fertiges Manuskript. Sein Kopf ist unklar, verworren, wie kurz vor einer erneuten Spirale, träge Gedanken, wie Mürbeteig, aus denen Bilder auftauchen. Er nimmt die Feder, streicht ihr zärtlich über den Schaft, streut Sand über das nach Sandelholz duftende Papier und beginnt eine Arbeit, deren Szenen und Titel häufiger Änderungen unterzogen werden. Er kennt die Richtung nicht, die erste Regung des Herzens nennt er den Roman zunächst und immer hat er Elisa vor Augen. Er muss die Worte tanzend machen, damit er einen unterdrückten Schrei für die absolute Schönheit, die ihn leitet in die Welt bringt, jenen Schrei, den Worten nie eingefangen.
Der Fluch des Blutes, der Chirurg steckt in ihm. Ständig misst er Fieber und diagnostiziert seinen Leib. Er sei schizophren, vertraut er seinem engsten Freund Louis Bouilhet an, schließlich sehe er sich stundenlang stumm beim Schreiben zu. Dieser wirft einen zweiten Blick über das Gelesene. Es könnte doch ein Meisterwerk sein, gibt er zu bedenken. Flaubert erwidert, offensichtlich irr geworden: „ Alle Meisterwerke sind dumm. Ein bunter Misthaufen farbloser Geschichte.“
Etwa sechs Seiten schreibt er pro am Tag, wenige Zeilen behält er über, manchmal gar keine oder nur ein Wort. Alles um ihn herum verschwindet, er sitzt ungekämmt im Bademantel auf dem Sofa, träumend, wie es scheint, darauf vertrauen, dass ein Bild hinter dem Vorhang auftaucht. Dann wieder liest er eine Zeitung nach der anderen, ein Buch und noch eines, unterbrochen nur von der Notdurft. Die Mutter sitzt unten, schon früh zu einem wertvollen Möbelstück verkommen, das besorgt von einem Zimmer ins andere gestellt wird.
Februar 1848. Das Jahr, das alle seine Hoffnungen auf Revolution zunichtemacht. „ Die Märzrevolution ist einer der schärfsten Einschnitte der französischen Geschichte mit einem romantischen Drang zur Totalität. Flaubert wurde zum Erfüllungsgehilfen eines Prozesses degradiert, der das skrupellose Kalkül, den Egoismus, der Individuen und Gruppen an die erste Stelle rückte .“ 43
Neue Rosen auf dem Tisch, gen Osten ausgerichtet. Vorbereitung ist alles, täglicher Schlaf und Traum, der Rhythmus des Leibes, dürfen nicht gestört werden. Vom Frühstücksei bis zur Nachtglocke ist alles geregelt. La Préparation du roman , diätetische Ethik, 44die Neurose ist immer anwesend. Der Schriftsteller Flaubert ist Perfektionist, getrieben von dem Verlangen Wunsch, einen perfekten Roman zu schreiben, in dem kein Wort fehlt und keines überflüssig erscheint. „ Mein Leben ist kein Tun, nur Gedanke und Illusion .“ Schreiben ist ewiger Selbstbetrug und doch geht sein Verlangen nach ihm tiefer als zu einer Frau.
Die Beziehung zu Louise Colet geht zu Ende. Angefangen hat es mit Kerzenschein, Kaminfeuer, geendet hat es in der immer selben Tinte, dem ewig gleichen Fliederduft-Papier, dem roten Federkiel auf dem Schreibtisch. Wenn ihm etwas misslingt oder er eine Blockade hat, nimmt er Platz auf einem grünen Plüschsofa. Rituale, Fetisch, Disziplin. Immun gegen zeitgenössische Kritik hört er nur auf seine Freunde Bouilhet und du Camp. Entscheidend für die Poesie ist das Streichen von Überflüssigem, ein misslungener Satz und die sorgsam aufgebaute Atmosphäre ist ruiniert. sagt Flaubert. Auch die Materie hat Herz. Um das Ganze zu retten, muss das Einzelne sterben. Er streicht eine Blüte, einen Satz und dann, nach kurzer Überlegung einen zweiten. Alles muss beobachtet werden. Schließlich lebt er für das Schreiben oder gar nicht.
Nur einmal fragt ihn der Freund, ob er noch an die Demokratie glaube. Sie sind zusammen nach Paris gereist, als geschossen wurde, damals, am 23. Februar. „Wir haben heiße Maronen gegessen“ Er scheint sich zu erinnern, der Blick hellt sich kurz auf, die Mundwinkel zucken leicht, als spüre er den Geschmack von damals nach. Louis denkt an die Schüsse, als sie in die Palais des Tuleries eingebrochen sind. „Du hattest einen roten Schal auf, den du dann mir gegeben hast, weil ich so fror.“ Gustave fasst sich an den geschwollenen Hals. Er ist dickleibig geworden, lässt sich gehen, seit er nicht mehr mit der Colet zusammen ist. Er hat wieder an seinem Smarh gesessen, dieser Geschichte mit dem Heiligen Antonius, die keiner kapiert. Dann hat er angefangen über die Revolution zu schreiben, aber auch lethargisch, ohne wirklichen Antrieb. „Du hast mich auf die Idee von Emma gebracht“ sagt Gustave.
Zwei Jahre hat er sich mit ihr herumgetragen, dann hat er den ersten Satz geschrieben. Vorher sind er und Maxime du Camp in den Orient aufgebrochen. Süchtig nach Luxus ist sie, sagt er, als er Louis zum ersten Mal nach über einem Jahr Reise in die Arme schließt. Er meint nicht die Schlésinger und auch nicht die Colet, er meint Emma Bovary, die eigentlich Delphine Dalamare heißt. Das hat ihn motiviert, den Roman wirklich zu schreiben. Nicht das Rattengift und auch nicht der doppelte Ehebruch, der versuchte Gattenmord, nur die Tatsache, dass sie den Stadtplan von Paris auswendig kannte, jedes Geschäft, das sie nie betrat, jede Gasse, jede Straßenlaterne darin. Ob er noch an die Demokratie glaube, fragt Louis nach, als ihm das Schweigen des Freundes zu laut wird. „Pah“, antwortet dieser. Die Literaten von heute träumen vom Meer, wenn es im Sturm liegt, doch sie lassen ihre Boote im Hafen, bis er sich gelegt hat.
1 II. 2. Flaubertismus
Das Wort flaubertisme kreiert Léon Daudet, dessen eigene Romane erfolglos bleiben und der sich in der Dritten Republik einen Namen als antisemitischer und xenophober Deutschlandhasser macht und der eine glücklose Ehe mit einer Enkelin Victor Hugos führt. Als Sohn des Zeitgenossen Flauberts und Schriftsteller Alphonse Daudet sind ihm einige Interna Flauberts bekannt, vielleicht ist er ihm als Kind begegnet. Während der Dreyfus-Affäre in strikter Opposition zu Zola schreibt er für rechtspopulistische Zeitungen. 1914, kurz nach Kriegsausbruch schreibt er, es bedürfe in Frankreich wieder mehr flaubertisme. Dass er damit die Art, wie Flaubert zu schreiben meint, ist selbsterklärend. Er selbst fügt nur ironisch-rustikal als Synonym dafür an. Inzwischen ist der Begriff, zumindest in Frankreich, ein fester Bestandteil des Literaturkanons, um ihn von dem Realismus eines Balzac oder eines Naturalismus eines Zola abzugrenzen.
Corneille und Racine hatten ihren Querelle du Cid 45und ihren Streit über die wirkliche und die vorgestellte Wirklichkeit, die Präsenz im Präsens. Flaubert und Baudelaire haben ihren Prozess. 1856 und 1857 werden sie wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt. Die Revue de Paris veröffentlicht am 1. Oktober 1856 einen Auszug aus „Madame Bovary “ , den ihr Autor nach sieben Jahren Arbeit für abgeschlossen erklärt. Wegen der detaillierten Schilderung des Ehebruchs der Protagonistin, hinter der ein authentischer Kriminalfall steckt, werden Flaubert und die führende Zeitung eines Verstoßes gegen die Moral und die Religion angeklagt. Flaubert wird schließlich am 7. Februar 1857 freigesprochen, zum einen, weil er einen guten Anwalt hat, zum anderen, weil der Staatsankläger unvorbereitet ist und den Roman gar nicht kennt, darüber hinaus hat Flaubert Geld und kann glaubhaft machen, dass er nicht auf Tantieme angewiesen ist. Das Werk wird nicht zensiert und ein Erfolg, denn er hat durch den Prozess ungewolltes, doch wirksames Aufsehen erregt.
Читать дальше