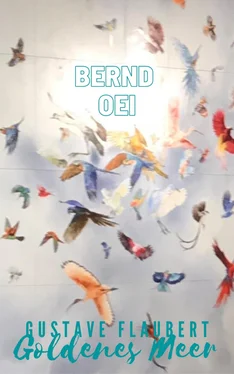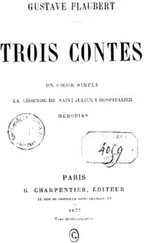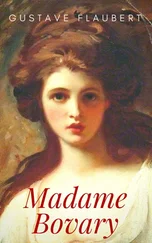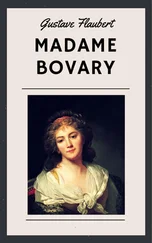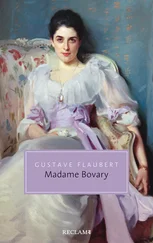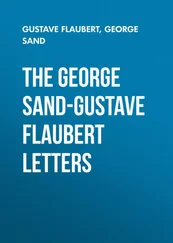Der Autor besteht zudem auf einer Trennung von künstlerischem, produzierendem und historischem Ich, was für Sartre eine affektierte und neurotische Komponente hat, da sich seiner Auffassung nach das Subjekt nie aus dem Kontext des Schreibens lösen kann. Gerade Flaubert darf man nicht auf sein Leben reduzieren, obgleich er zu den Schriftstellern gehört, die nichts anderes tun, als ihr eigenes Leben künstlerisch zu verarbeiten, worin er Kafka vorwegnimmt.
Zu Zeiten des Bürgerkönigs Louis Philippe lässt man generell die Bilder nach Wandmaß anfertigen und bezahlt sie nach Fläche, d.h. Leistung nach Quadratmetern. Die Künstler sind Fabrikarbeitern gleichgestellt, Qualität wird berechenbar und nach Produktionsaufwand vergütet. In keinem Roman außer in Flauberts „Die Schule der Empfindsamkeit“ ist dies erwähnt. Zum Flaubertisme gehört auch Anachronismus der Geschichte. So sagt der Autor, er schreibe über das Sein nur, um das „Nichts“ zu finden, die Leere hinter der dinghaften Welt.
„Madame Bovary“, der Jahrhundertroman, richtet sich gegen Stendhals Kristallisationstheorie der Illusionen, gegen Balzacs Willen zum Erfolg und gegen Hugos Sentimentalität der Selbstlosigkeit in der Liebe. „Salambô“ bricht mit dem gängigen Bild des Orients, das durch die Bilder Delacroix geprägt ist. Flaubert öffnet und weitet die Bühne für die Moderne, ungeschminkt aufzutreten. Er ist ein Décadent, wie Paul Bourget, der den Begriff les décadents prägt und der mit seinem Motiv „Verbrechen aus Liebe“ Emma Bovary zum Vorbild nimmt. Auch Zola in „Thérèse Raquin“ und Mauriac in „Thérèse Desqueyroux“ beziehen sich auf Flaubert, nicht nur auf Motiv und Typus von Madame Bovary, sondern auch auf ausbleibendes Bedauern oder Erklärung für die außergewöhnliche Tat.
Nietzsche bezeichnet diesen Aufstand gegen die sekundäre Welt durch Flaubert als Skeptiker an der (konstruierten) Wirklichkeit als „ Schule des Misstrauens“ , worunter er die „ principielle Verachtung der Sphären “ versteht.
Flaubertisme repräsentiert eine ästhetische Revolution, wie sie im Impressionismus und Naturalismus ihre Fortführung erlebt, eine Wahrheit, die größer und tiefer ist als die Wirklichkeit, in der sie stattfindet, eine subtile Bewegung, die gegen die Verklärung der Realität protestiert. Flaubert zeigt, dass Realität selbst banal und an sich leer ist, einzig durch Illusionen lebendig und entzaubert wird wie jedes Glück. „ Er setzt der Erzählung keiner Mimesis gleich, sondern den Denk-und Sprechweisen .“ 53Die Vorlage für Proust.
„Salambô “ gibt Rätsel auf, denn nach einem so modernen Roman, der nicht nur die gegenwärtige Zeit zum Inhalt hat, sondern auch eine bis dahin unbekannte Erzählhaltung einnimmt, enttäuscht er die Erwartung. Das Werk ist romantisch, insofern sein Autor unsterblich in den Orient verliebt ist, dennoch steht die Desillusionierung der Antike, das Bild, das sich der Leser von ihr macht, im Vordergrund. Auch schreibt er entgegen der Zeit des Bürgertums keinen Entwicklungsroman; seine Charaktere erreichen nichts und entwickeln sich bestenfalls zu ihrem Nachteil, was formal den Anti-Bildungsroman im Expressionismus vorwegnimmt. Realismus, Positivismus, Fortschrittsgläubigkeit und technisches Interesse wie die Einbettung der Eisenbahn in die Belletristik gehören im 19. Jahrhundert zusammen. Ansatzweise geschieht dies, wenn Flaubert über die Fayencen in „L´Education sentimentale“ schreibt. Doch sein style évocatrice berauscht sich an den Formulierungen, nicht an den dargestellten Objekten.
Subjektivismus mit Objektivismus erscheinen in der Auflösung versöhnt, was dem deutschen Idealismus entgegensteht und Bergson ( élan vital ) oder Proust ( rétour du temps perdu ) vorauseilt: die Wirklichkeit führt bei ihm zur Verinnerlichung der Zeit. Die Räume haben qualitative Bedeutung und keine quantitative Ausdehnung. Vorstellung und Darstellung kollidieren und bilden keine Symbiose, Realismus mit seiner Richtigkeit oder Nützlichkeit werden gleichgültig. Flaubertisme impliziert esthétique pure , ungefilterte Empfindung. Der Ausdruck für zweckfreie Kunst l ́art pour l ́art stammt von Baudelaire, den Flaubert erstmals im Salon von Apolline Sabatier 1852 begegnet. Auch der Flaubertisme fordert Autonomie der Kunst, aber nicht wie die Entwicklung im Symbolismus Mallarmés kulminierend, auf Kosten des Inhalts und der Verständlichkeit. Für den Romancier bedeutet es Unabhängigkeit der Imagination vom „Ding an sich“ und auch von Ideen für sich wie sittlichen und politischen Gehalt.
Flaubert beschreibt die Ehe durch Auslassung und Nicht-Kommunikation. Er demaskiert die Liebe als Illusion, die scheitert, sofern sie sich realisiert und das Gegenüber erkannt wird. Als Beispiel dient Flauberts Adaption der Novelle „ Une femme de trente ans “ 54. Balzacs Schilderung der dreißigjährigen Gattin Julie d'Aiglemont und das Portrait ihrer unglücklichen Ehe mit einem oberflächlichen Reiteroffizier führt zum gleichen Ergebnis: dem Betrug, anschließendem Unglück und Selbstmord. Bis zu Tolstois Anna Karenina lässt sich die Liste erweitern, weil der Stoff so alltäglich und banal ist. Balzac erklärt das Scheitern der Ehe durch die ökonomischen, sozialen und physiologischen Determinanten ( physiologie du mariage ), die in seelisches Unglück ( psychologie de mésalliance ) hervorrufen. Dagegen scheitert die Ehe von Emma und Charles Bovary weder an Geld, Stand, Konfession oder Konvention, sie ist bedingt durch Emmas Naturell, ihre Hingabe an die Romantik bei Charles Nüchternheit eine Unmöglichkeit.
Vergleicht man Emma mit Stendhals „ La Charteuse de Parma “ 55, so wirkt Stendhals Roman als Tribut an einen Kanon, der sündiges Verhalten bestraft: Mutter und Kind sterben aufgrund des Ehebruchs. Flaubert ist ungleich moderner als seine beiden Vorgänger. Die Beliebigkeit der Dinge in Bezug auf die Bedeutung im Inneren steht im Vordergrund. Hugo von Hofmannsthal berücksichtigt dies und bezieht sein Theaterstück „Jedermann“ auf dessen Aussage „ Jede könnte Madame Bovary sein. “ .Die Redewendung „Madame Bovary, das bin ich“ wird sehr häufig zitiert, aber falsch kommentiert. Es geht Flaubert niemals darum zu betonen, dass er hinter der Figur steckt und sich mit ihr identifiziert. Sein Konzept der Unbeweglichkeit, das nie Komplizenschaft oder Identifizierung mit einem Perspektiventräger erlaubt, nennt Flaubert impassibilité .
Maxime Du Camp verweist auf Descartes´ Maxime „Ich denke, also bin ich“ und die Frage nach der doppelten Identität aus Sein und Denken von Sein bzw. Leib und Geist. Denn ich bin ich ist eine Tautologie, wenn man die beiden Subjekte nicht substanziell unterschieden werden in res cogtitans und res cogitare. Flaubert will Subjekt und Objekt mit Prädikat voneinander trennen. Er dissoziiert. Selbiges Prinzip gesteht auch Flaubert: „Ich bin und bin doch nicht. Ich bin sie, weil sie nicht ich sein kann.“
» Bovary, en ce sens, aura été un tour de force inouï et dont moi seul jamais aurai conscience : sujet, personnage, effet, etc., tout est hors de moi .« 56(„Bovary, in diesem Sinn, wird eine gewaltige unerhörte Anstrengung und dessen ich mir niemals bewusst geworden bin: Thema, Charaktere, Ergebnisse etc., alles liegt gänzlich außerhalb von mir.“) Baudelaire ergänzt in der Literaturzeitung L´ Artiste 1857: der Autor habe sich zur Frau machen müssen, um eine Heldin zu erzeugen, die im Grunde männlich handelt .
1 II. 3. Briefwechsel mit Louise Colet
Die Beziehung mit Beziehung mit der (wie Elisa Schlésinger) zehn Jahre älteren Louise Colet beginnt im Juli 1846, wenige Monate nach dem tragischen Tod seines Vaters und dem weit mehr betrauertem Kindbetttod seiner Schwester und endet nach zwei reisebedingten Unterbrechungen September 1854, als sie darauf besteht, ihn in Croisset zu besuchen und damit seiner Mutter vorgestellt zu werden. Dreifach ist die Liaison von Bedeutung: Flaubert verlässt sie zweimal für die Poesie, er entscheidet sich bewusst für das Schreiben und gegen die Liebe; eine Situation die auch Hölderlin, Kierkegaard und Kafka durchlaufen, die möglicherweise auch Nietzsche und Lou Salomé bzw. Rilke und Lou Salomé betreffen. Zweitens ist die Frau die wesentlich erfolgreichere Schriftstellerin von ihnen beiden, was den Zeitgeschmack dokumentiert und die Tatsache belegt, dass Genies gewöhnlich ihrer Zeit voraus sind; während Louise Colet die Romantizismen mit ihren klischeehaften Vorstellungen bedient, verweigert sich Flaubert der Massenästhetik und Sonntagsliteratur. Drittens liefern seine Briefe einen Nachweis seiner Ästhetik und seiner Arbeitsweise, so dass Flaubert aus sich selbst heraus verständlich wird.
Читать дальше