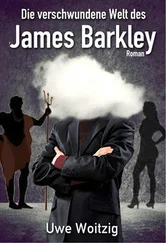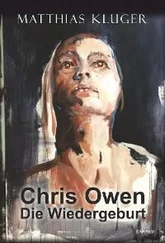Larkyen schüttelte den Kopf.
„Mir gehen diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf“, flüsterte er. „Wie die Kedanier meine Leute töteten. Sobald ich die Augen schließe, sehe ich Blut in Strömen fließen, und ich sehe ihre Köpfe, wie sie über den harten Boden rollen. Ich sehe den Leichnam meines Weibes, den leeren Blick ihrer Augen. Und ich konnte nichts tun, konnte nichts daran ändern.
Ich glaubte einmal zu wissen, was es heißt, ein Nomade zu sein. Seit ich denken kann, bin ich mit den Yesugei durch die Steppenlandschaft Majunays gezogen, vom Kharasee bis zum Fluss Nefalion weit im Osten. Ich war immer an ihrer Seite, kümmerte mich um das Vieh und lernte, ein guter Reiter zu werden. Doch all meine Anstrengungen waren umsonst, weil ich ihnen in der schwersten Not nicht beistehen konnte.“
Larkyen war sich im Klaren darüber, dass so vieles aus seiner Vergangenheit ihm nicht mehr von Nutzen sein konnte. Was hieß es jetzt noch, ein Nomade zu sein? Die Nomadenstämme in ihrer Friedfertigkeit glaubten, dass die Steppe mit ihren unendlichen Weiten für alle genug Platz zum Leben bot. Konflikte mit anderen Stämmen waren ihnen, die die Nähe von Fremden stets gemieden hatten, so gut wie unbekannt. Zweifellos war das Leben in der Natur ein Ringen und Kämpfen gegen ihre Widerstände. Anpassung konnte über Leben und Sterben entscheiden. Ein Nomade maß seine Kräfte lediglich mit den Jahreszeiten, die ihm vertraut waren wie sonst keinem. Doch egal, wie sehr Witterung und schwere Arbeit einen Nomaden abgehärtet hatten, so schien es doch, dass die gegenwärtigen Tage nur denen gehörten, die Erfahrung im Kampf mit dem kalten Stahl hatten.
Die Zeit des Krieges gehörte den Kriegern.
Larkyen trat ein paar Schritte hinaus in die Dunkelheit, atmete tief durch und starrte lange und nachdenklich in die Nacht. Ojun, der ihm nachgegangen war, legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter und sagte:
„Die Dunkelheit der Nacht lässt unsere Sorgen und Nöte mitunter so gewaltig erscheinen, dass sie uns erdrücken können.“
Trotz seiner langen Einsamkeit konnte der Schamane die Gefühle eines Menschen noch gut nachvollziehen.
Larkyens Wunsch, das Leben eines Nomaden wieder aufzunehmen, war unendlich groß, doch er würde sich nicht erfüllen, das wusste er.
Die Realität war ein Ort von unermesslicher Härte, der nur durch gute Erinnerungen Einhalt geboten werden konnte.
Er rief sich das Gesicht seiner Adoptivmutter Tsarantuya vor Augen, ihr gütiges und fürsorgliches Lächeln, stellte sich die tiefe und markante Stimme seines Adoptivvaters Godan vor, wenn er nach ihm rief. Die langen Ausritte mit Alvan durch die weite Steppe, zu den Herden der wilden Pferde. Doch der Mittelpunkt all dieser Momente war stets Kara.
Larkyen überlegte, wie es wohl gewesen wäre, das gemeinsame Kind im Arm zu halten, wie dessen kleine Finger nach seiner Hand tasteten. In das junge Antlitz zu blicken, um darin einen Teil von sich selbst wiedererkennen zu können. Wie alle Väter wollte er Vorbild sein und sein Kind bis ins Erwachsenenalter begleiten. Larkyen hatte all das zurückgeben wollen, was er selbst durch die liebevolle Fürsorge seiner Adoptiveltern erfahren hatte.
Es hatte sogar Tage gegeben, an denen er sich das große Abenteuer gewünscht hatte. Nun steckte er mittendrin und trauerte um den friedlichen Alltag und die Menschen, die mit ihm ihr Ende gefunden haben.
„Larkyen“, sagte Ojun. „Begib dich in die Jurte; frei von Unruhe und Sorgen sollst du diese Nacht sein. Ruhe dich auf den Fellen aus und schlafe.“
Vielleicht hatte der alte Schamane Recht. Schlafen schien in diesem Moment die beste Lösung zu sein. Schlafen, um aufzuwachen und festzustellen, dass alles nur ein böser Traum gewesen war.
Er ging zurück zu der Jurte. Bevor er eintrat, drehte er sich noch einmal zu dem alten Mann um und verbeugte sich tief, wie es im Osten der Welt Brauch war.
Sein Schlaf in dieser Nacht war tatsächlich frei von Sorgen und bösen Träumen.
Der folgende Tag war sonnig und angenehm warm. Der Sommer zeigte sich noch einmal in voller Pracht.
Larkyens Leib schmerzte innerlich, so als würden hunderte glühende Nadeln seine Eingeweide bearbeiten. Noch immer floss das Gift in seinen Adern, und die Wunde unter seinem Verband war geschwollen und blau angelaufen. Ganz gleich, wie groß die Pein war, er stieß nicht einen einzigen Schrei aus. Ojun bestrich die Wundränder mit einer Essenz aus herb duftenden Kräutern, darüber legte er einen neuen Verband an.
Auf Geheiß des Schamanen schonte Larkyen seine Kräfte noch, indem er die meiste Zeit auf seinen Fellen in der Jurte lag, oder wenn es ihm zu heiß wurde, draußen in der Sonne vor sich hin döste.
Ein Stück entfernt von der Jurte befand sich eine Feuerstelle mit knisternden Holzscheiten. Wenn er wach war, ließ er sich manchmal auch dort nieder. Dann blickte er in die Flammen. Wieder einmal gab er sich dabei Gedanken an Kara hin. Die einzige Frau, die er je geliebt hatte.
Es hatte eine Weile gedauert, bis auch der Stamm der Yesugei ihre Liebe anerkannt hatte. Und durch die Zustimmung zu ihrer Vermählung hatten die Yesugei mit einer alten Stammestradition gebrochen, die besagte, dass die Liebe einer Majunayfrau auch nur einem Majunaymann gehören darf. Nie zuvor hatte es eine Vermählung zwischen einer Nomadin und einem Kentaren aus dem Westen gegeben. Alles nur weitere Erinnerungen.
„Hast du denn nichts für mich zu tun?“ fragte er den Schamanen, der soeben ein dreibeiniges Metallgestell über den Flammen aufbaute und einen mit Wasser gefüllten Kessel daran aufhängte.
„Du musst dich erholen“, antwortete Ojun.
„Viel eher muss ich mich ablenken.“
„Ich verstehe, dass dir deine Lage nicht gefällt. Doch dein Körper benötigt alle Kräfte, um das Gift in dir abzubauen.“
Der Schamane hatte am Morgen eines der Tiere geschlachtet und bereitete nun das Fleisch zu, ehe er es zum Kochen in den Kessel gab. Nach einiger Zeit schwängerte der kräftige Geruch von Schafsfleisch die Luft.
Der Tag schien kein Ende zu nehmen. Larkyen war froh, wenn der Schamane ihn abermals in tiefem Schlaf versinken ließ.
Beim morgendlichen Verbandwechsel sah die Verwundung noch immer beängstigend aus, auch wenn die Schwellung deutlich zurückgegangen war.
„Ich spüre bereits, wie es mir besser geht“, stellte Larkyen fest. „Es tut nicht mehr allzu weh.“
„Du hast deine leiblichen Schmerzen bisher gut unter Kontrolle gehabt. So viel steht fest. Du bist ein zäher Bursche. Und die Heilkräuter tun ihr übriges und entfalten ihre Wirkung, aber deine vollständige Genesung wird dennoch einige Zeit brauchen.“
„Du hast viel für mich getan, Schamane. Genesung hin oder her. Lass mich bis dahin tun, was ich kann, um meine Schuld bei dir zu tilgen.“
„Du schuldest mir nichts“, gab Ojun trotzig zurück. „Und du solltest in deinem Zustand auch nicht übermütig werden.“
Und als der Schamane ihn daraufhin beschämt anblickte, fügte Larkyen rasch hinzu: „Du darfst das Angebot eines Yesugei nicht abschlagen, Schamane. Du würdest mich damit beleidigen.“
„Eigentlich solltest du dich noch ausruhen. Aber es geht dir wirklich um ein Vielfaches besser. Dann mach dich eben nützlich, du Sturkopf. Aber denk auch an deine Wunde, und dass du noch schwach bist und …“ Ojun winkte ab und schüttelte den Kopf. „Du weißt es ja doch besser“, grummelte er.
Larkyen lächelte.
Der Schamane machte zunächst keinerlei weitere Anstalten, Larkyens Hilfsbereitschaft auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Irgendwann jedoch schickte er ihn in den Wald, um Feuerholz zu sammeln. Larkyen war froh, sich endlich nützlich machen zu können. Er genoss es, zwischen den Bäumen umherzugehen, und sah sich neugierig in ihren Kronen um. Er entdeckte Vögel, denen er in der Steppe niemals begegnet war, und lauschte ihrem Zwitschern. Als er mit dem Feuerholz zurück zu der Jurte kam, spürte er, wie Schwäche ihn übermannte und seine Knie weich wurden. Der Schamane bemerkte es sofort und eilte ihm entgegen.
Читать дальше