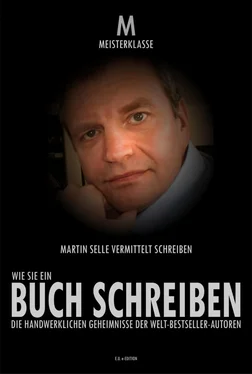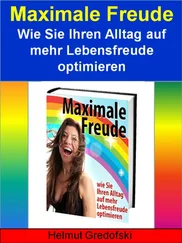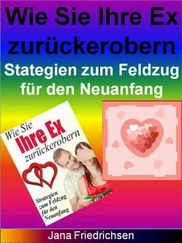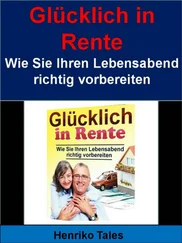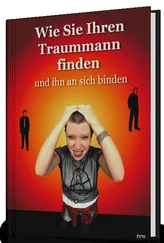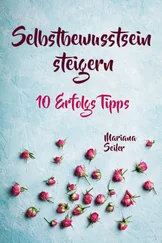Manische Figuren glauben, sie können alles und jeden erreichen. So könnte Ihr Held über Leichen gehen, um sein Ziel zu erreichen.
Schizophrene wirken schüchtern, unsicher, verlegen und äußerst sensibel. Man hat das Gefühl, nie wirklich zu wissen, woran man ist.
Paranoiker fühlen sich ständig von allen anderen verfolgt und neigen deshalb zu Aggressivität, sie wollen der Anführer sein.
Angstneurotiker fürchten sich vor allem und jedem. Sie machen sich ständig Sorgen um Gott und die Welt. Überall vermuten sie Untergang und Verderben.
Bedenken Sie, dass solche Charaktere immer (auch zum Ende Ihrer Geschichte) bleiben, was sie sind. Abnorme Personen ändern sich nicht grundlegend. Die Psychopathin wird nicht plötzlich die liebevolle Säuglingsschwester sein können.
Suchtverhalten wirkt auf den Leser abnormal. Stellen Sie sich vor, Ihr Held verspeist jeden Tag zehn Tafeln Schokolade, die Kindergärtnerin bringt liebend gerne achtjährige Mädchen um, zerstückelt sie und schickt den Eltern mit der Post Teile nach Hause. Das geht unter die Haut.
Abnormitäten rütteln an unseren Gefühlen und machen Figuren somit interessant und leichter erinnerbar.
Die Profi-Methoden zur Blitzcharakterisierung
Bei den nachstehend von mir beschriebenen Techniken geht es um die Klassenunterschiede zwischen Menschen, um kulturelle Herkunft und gesellschaftlichen, sozialen Status. Diese Themen werden oft als Tabus behandelt. Als Schriftsteller brennen Sie natürlich darauf, Tabus zu brechen, das ›Verbotene‹ aufzuzeigen, denn heikle Themen rufen emotionale Reaktionen hervor.
1. Kultureller Hintergrund
Kulturelle Unterschiede sind ein wesentliches Merkmal von Figuren. Sie entstehen aus angeborenen Eigenschaften, dem familiären Hintergrund, der Herkunft, der Religion. Solche Unterschiede liefern Ihnen als Autor den Konflikthintergrund. Die Technik besteht darin, Figuren zu entwerfen, die verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Gemeint sind Traditionen, Verhaltensmuster, staatliche Institutionen, Brauchtum, religiöses Verhalten, Erziehung, Bildung. Statten Sie Ihre Figuren mit unterschiedlichen, über Generationen weitergegebenen Charakterzügen aus, die im kulturellen Hintergrund wurzeln. Ein hinduistischer Inder ist und reagiert anders als ein katholischer Deutscher.
2. Soziale, gesellschaftliche Schicht
Die Klassenzugehörigkeit charakterisiert Menschen. Diese Zugehörigkeit können Sie vielseitig zum Ausdruck bringen. Ein Millionär kleidet sich wahrscheinlich anders als ein Habenichts. Die Hände einer Putzfrau sehen vielleicht anders aus als die manikürten Hände einer Managerin. Figuren aus unterschiedlichen sozialen Schichten bergen ein enormes Konfliktpotenzial in sich. Um diese Unterschiede für den Leser leicht erfassbar zu machen, zeigen Sie einfach Merkmale, die den sozialen oder kulturellen Hintergrund der Figur signalisieren: Kleidung (Soldaten tragen Uniform), Gegenstände (Halbmond oder Kreuz), Symbole (der Ferrari vor der Tür).
Auf diese Weise assoziiert der Leser die Figur aufgrund eines Erkennungsmerkmals mit einer bestimmten Schicht. Sie müssen das nicht umständlich schildern. Es reicht, wenn Sie dem Leser das Erkennungsmerkmal nur nennen, das Bild oder die Handlung sprechen für sich: der goldene Siegelring am Finger des Mannes, die Punkerfrisur, der Akzent, Essgewohnheiten, auffällige Angewohnheiten der Ober- oder Unterschicht, Wortwahl (Gaunersprache, Professorendeutsch …), Inhalt von Aussagen (eine gebildete Figur verwendet Fremdwörter korrekt, hat geschichtliches Wissen, ist belesen; der ungehobelte Rüpel äußert sich vielleicht nahezu inhaltslos).
Insider-Tipp: Suchen Sie nach Klassenmerkmalen, die Sie in das Handeln der Figur einarbeiten können, indem Sie zeigen, was die Figur tut, und die dabei gleichzeitig etwas über das Milieu der Figur aussagen. Appellieren Sie an die Gefühle Ihrer Leser.
Denken Sie an Welterfolge wie James Camerons ›Titanic‹. Rose soll einen Mann aus reichem Hause heiraten, um zu Geld zu kommen. Sie selbst stammt jedoch aus ärmlichem Hause. Und Jack, in den sich Rose verliebt, entspringt ebenfalls der Unterschicht. Er reist im ›Keller‹ der Titanic mit, während Rose in den Luxusräumen logiert. Die Liebe als Vehikel – große Gefühle, elf Oscars. Sie verstehen die Technik.
Die Meisterformen der Figurenpräsentation
Wie teilen Sie dem Leser nun die charakteristischen Merkmale Ihrer Figuren mit? Indem Sie diese einfach und plump mitteilen, aufzählen? Nein, sicher nicht. Als Autor sind Sie kein Nachrichtensprecher, der Fakten verkündet, Sie zielen darauf ab, dem Leser die Geschichte lebendig zu zeigen, für ihn erlebbar zu machen. Dazu gibt es einige bewährte Profi-Techniken.
1. Vorstellung zu Beginn der Geschichte
Hierbei schildern Sie Ihre Hauptperson zu Beginn der Geschichte. Sie teilen dem Leser charakterisierende Merkmale und Eigenheiten mit – idealerweise durch Handlung:
Tim Timberton presste sich durch den Türrahmen. Das Prädikat sportlich verlieh ihm mit Sicherheit niemand der anwesenden Aristokraten. Aus seinem Gesicht sprachen die Züge irischer Einwanderer, versteckt hinter einem Doppelkinn und runden Backen. Sein roter Haarschopf fiel ihm wie üblich ins Gesicht, und seine hellwachen grünen Augen musterten die Szene mit dem Scharfsinn des unbeeindruckten Detektivs, als er sagte: ›Würden mir die ehrenwerten Herren bitte die Leiche und den Ort des Ablebens zeigen?‹
Hier wird die äußere Erscheinung geschildert, ein Name vergeben, der Leser erhält handelnd Informationen über die gesellschaftliche Schicht, den Beruf des Helden.
2. Das Shading (Schattenmalerei)
Bei dieser Technik zeigen Sie die negativen, die Schattenseiten, einer Figur. Wie machen Sie das? Ganz einfach: Sie schildern dem Leser eine unsympathische Seite des Helden - zum Beispiel einen Heerführer, den der Tod seiner Soldaten völlig kaltlässt. Später zeigen Sie eine Szene, in der wir die liebende Sorge des Heerführers um seine Männer erfahren – vielleicht, indem er sich Vorwürfe macht über die falsche Verteidigungsstrategie oder wie er Verletzte besucht und aufmuntert. Wir erfahren im Nachhinein, dass das Wesen der Figur ein gänzlich anderes ist, als seine Schattenseite zu Beginn nahelegt.
3. Auslassen
Lassen Sie eine Präsentation Ihrer Figur ganz bewusst aus. Wie erfährt aber dann der Leser die Merkmale der Figur? Die Technik funktioniert so, dass sich Ihr Held nach und nach in der Geschichte darstellt, im Verlauf seines Handelns durch Taten, Aussagen, Reaktionen auf Ereignisse und Reaktionen anderer Figuren auf ihn charakterisiert.
Fünf Minuten später saßen sie an einem wackeligen Ecktisch in einem menschenleeren Pub und warteten auf ihr Essen.
Larry schaute hoch zu dem Kellner, der ein Tablett herantrug. Steak-und Nieren-Pudding für ihn, Red Snapper mit Salat für Hank.
Larry schnitt mit seinem Messer in den weichen Teig, worauf Dampf und Bratensoße hervorquollen.
»Das ist Herzinfarkt auf Raten«, meinte Hank lakonisch. »Weißt du, was da drin ist? Fett – reines Fett. Igitt!«
Larry schaufelte sich Senf auf den Teller. »Das Problem liegt im Kopf, nicht auf dem Teller. Das Grübeln bringt dich um.«
Hank antwortete nicht, er kaute auf seinem Fisch. Deshalb sprach Larry weiter: »Seefisch weist einen hohen Quecksilbergehalt auf, hab ich wo gelesen. Höchstens einmal die Woche zu essen.«
Unbehaglich kaute Hank etwas langsamer. »Woher hast du denn das?«
»Nature.«
»Schieße. Mandy kocht vier Mal die Woche Fisch. Quecksilber?«
»Du endest noch als Fieberthermometer.«
Читать дальше