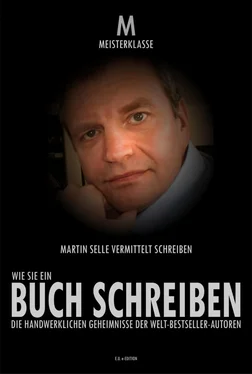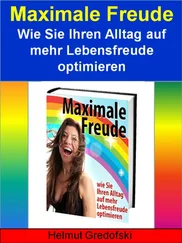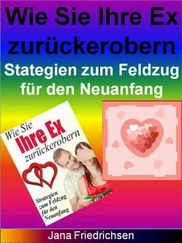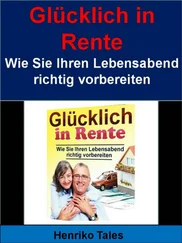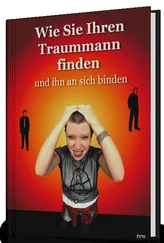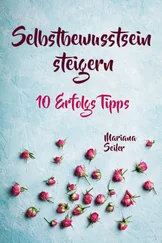4. Schildern der Umgebung
Diese Form der indirekten Charakterisierung können Sie verwenden, um eine Figur zu beschreiben, ohne dass diese Figur vor den Augen des Lesers auftreten muss. Sie tun nichts weiter, als einen Schauplatz, einen Ort, ein Zimmer, ein Büro, in dem sich die Figur für gewöhnlich aufhält, zu beschreiben (zeigen).
Der Schreibtisch, ein edles Stück aus einem Königshaus, thronte direkt unter dem lebensgroßen Ölgemälde von Mozart. Neben dem Meister blickte er selbst in das Zimmer, mit seinen dunklen, zornigen Augen und seiner erhabenen Haltung eines Kaisers. Die schweren Samtvorhänge filterten den Großteil des Sonnenlichts aus, das bizarre Schatten von Marmorstatuen auf Perserteppiche und Parkettboden zeichnete. Der offene Kamin an der gegenüberliegenden Seite des Arbeitszimmers wurde von Bücherregalen aus Mahagoniholz gesäumt. Mit goldenen Lettern am Buchrücken und in edles Leder gebunden, reihte sich Klassiker an Klassiker.
Wir bekommen einen Eindruck von der Person, der dieses Arbeitszimmer gehört, obwohl die Figur selbst nicht auftritt. Der Schreibtisch aus dem Königshaus, Mozart, die Haltung eines Kaisers, schwere Samtvorhänge, Marmorstatuen, Perserteppiche. Offenbar handelt es sich um eine wohlhabende Person, die sich selbst auf der Ebene mit Größen wie Mozart und den Kaisern sieht. Ebenso hält die Person viel auf Bildung - Klassiker im Bücherregal, edel in Leder gebunden. Und dennoch erahnen wir etwas ›Dunkles‹. Die dunklen Samtvorhänge filtern Licht aus, dunkle, zornige Augen. Die Umgebung suggeriert den Charakter der Figur.
Im Zimmer eines Jungen, der sich für Musik interessiert, werden Noten zu sehen sein oder ein Instrument, ein Mädchen, das Reitunterricht nimmt, hängt sich vielleicht Poster von Pferden auf. Die Umgebung charakterisiert Personen.
›Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist‹, heißt ein wahres Sprichwort.
Weitere Insider-Geheimnisse
An dieser Stelle verrate ich Ihnen noch weitere Insider-Geheimnisse von Starautoren. Diese Kenntnisse versetzen Sie umgehend in die Lage, es wie die Profis zu machen. Beherzigen Sie diese Ratschläge zum Umgang mit den eben erworbenen Techniken.
Wenn Sie Ihrer Figur eine besonders originelle Eigenschaft geben, dann stellen Sie diese für den Leser gleich beim ersten Auftreten dar.
Ihr Held sollte im Verlauf der Geschichte eine Veränderung durchmachen. So könnte der Geizhals am Ende einem Kinderheim eine ansehnliche Summe spenden.
Schildern Sie Ihre Figuren durch szenische Handlungen, lassen Sie die Helden etwas tun, das ihren Charakter zeigt. Dadurch laden Sie den Leser ein, an einem Fantasiespiel teilzunehmen, er darf aktiv ›mitraten‹ und wird nicht vom Autor bevormundet.
So machen Sie Figuren sympathisch: Sympathie wecken Sie durch Attraktivität, Aktivität, Humor, Bildung, Mut, Intelligenz, Fair Play, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit. Statten Sie Ihren Helden mit solchen Fähigkeiten aus.
So machen Sie Figuren unbeliebt: Ablehnung erzielen Sie durch Eigenschaften wie Perfektion, Wortbrecherei, Sadismus. Mörder, Egoisten, Angeber sind unsympathisch. Ebenso belehrende, humorlose, sentimentale, obergescheite oder wehleidige Figuren lehnt der Leser ab.
Als guter Autor präsentieren Sie dem Leser Figuren, die bereits beim ersten Auftreten auf ihn außergewöhnlich wirken – Menschen, die sich von der Masse abheben.
Wenn Sie Probleme haben, den Charakter Ihrer Figur zu finden, dann benötigen Sie mehr Informationen über Ihren Helden. Folgende Methoden werden Ihnen dabei helfen:
1: Betrachten Sie die Figur aus einem anderen Blickwinkel heraus. Als Vater, Mutter, Freund, Nachhilfelehrer, Trainer.
2: Lassen Sie die Figur in einer gefühlsbetonten Situation über sich selbst erzählen. Vielleicht, wenn sich Ihr Held ärgert und wütend herausschreit, angetrunken ist (im Wein liegt die Wahrheit), den besten Freund bei einem Autounfall soeben verloren hat und trauert. In solchen Momenten kommen die Worte nicht rational aus dem Kopf, sondern aus dem Bauch heraus.
3: Stellen Sie sich vor, die Figur bewirbt sich in Ihrer Firma. Stellen Sie ihr beim Vorstellungsgespräch provokative Fragen, reizen Sie Ihre Figur und lassen Sie sich von ihr reizen.
4: Ihr Held könnte vor vielen Menschen eine Rede halten müssen und sich selbst vorstellen.
5: Stellen Sie sich Ihren Helden mit 90 Jahren vor und lassen Sie ihn rückblickend sein Leben schildern. Jede Frage und Vorstellung, die sich auf die Handlung einer Figur bezieht, ist dienlich, denn das Tun der Figuren ist das ideale Mittel der Charakterisierung.
Ihr Held sollte im Verlauf der Geschichte eine Veränderung durchmachen. Etwa könnte der anfängliche Angsthase am Ende mit dem Fallschirm springen, der zu Beginn bequeme Junge entwickelt sich zum Arbeitstier. Die Veränderung darf überraschend sein, sollte aber nicht im unmittelbaren Gegensatz stehen zu dem, was wir über den Helden wissen. Helden überwinden sich, aber sie legen einen grundlegenden Charakterzug kaum vollends ab.
Bei einem ›gelungenen‹ Bösewicht ist seine Bosheit ein Teil seines Wesens. Das Böse steckt unauslöschlich in ihm, er ist mit dem Bösen verbunden und tut nicht nur böse Dinge wegen seiner Rolle als Gegenspieler. Lenken Sie die Gefühle des Lesers in eine bestimmte Richtung, indem Sie dafür sorgen, dass der Leser dem Bösewicht ›Bestrafung‹ wünscht. Etwa wenn ein Abteilungsleiter einen Mitarbeiter mobbt und am Ende selbst aus der Firma fliegt. Das gefällt dem Leser. Wir empfinden es als befriedigend, wenn ein Bösewicht bekommt, was er verdient.
Insider-Tipp: Geben Sie Ihrem Bösewicht ein Merkmal, das er ununterbrochen wiederholt. Solche Angewohnheiten machen den Leser nervös, irritieren ihn - ständig die Nase aufziehen, Spucken, mit der Zunge schnalzen, an den Nägeln kauen. Ihr Bösewicht sollte einen von Grund auf schlechten Charakter besitzen, das ist effektiver als nur ab und zu eine böse Tat.
Nebenfiguren charakterisieren Sie am besten, indem Sie ein einziges Merkmal nehmen, das die Figur von allen anderen Menschen deutlich unterscheidet, und dieses klar und anschaulich hervorheben. Auf diese Weise erwecken Sie eine Figur besonders schnell zum Leben.
Nebenfiguren charakterisieren Sie ebenfalls schnell und deutlich, indem Sie diese aus der Sicht Ihres Helden schildern:
»… der Riese von Postbote, der mit dem Verteilen der Post immer bei uns im neunten Stockwerk seinen Arbeitstag beginnt, steigt jeden Tag um exakt sechs Uhr und vier Minuten aus dem Lift . Eine Minute später klingelt es an unserer Wohnungstür, und wenn ich öffne, sehe ich als Erstes seine dottergelben Augen. Ich hasse diese Kontaktlinsen an ihm.«
Wie fangen Sie an, eine Figur zu entwerfen?
Eine Möglichkeit wäre diese: Sehen Sie die Figur körperlich vor sich. Wie sieht sie aus? Wie bewegt sie sich? Wie spricht sie? Wie agiert und reagiert sie in einer Krisensituation? Eine Figur entsteht nicht auf einen Wurf, sie entsteht Stück für Stück, Schritt für Schritt. Und zwar, indem Sie durch Beobachtung kleiner Details einen ersten Eindruck gewinnen; dann fügen Sie durch Ihre innere Stimme Erfahrungen hinzu. Eine Figur kommt aus Ihrem Inneren, fragen Sie sich immer: Was würde ich in dieser Situation tun? So kommen Sie auf den Wesenskern der Figur. Anschließend verleihen Sie dem Helden Kontraste und Widersprüchlichkeiten, das macht ihn menschlich vielschichtig. Dann fügen Sie Wertvorstellungen, Überzeugungen, Standpunkte hinzu, das macht die Figur runder. Schließlich überlegen Sie sich ein paar Einzigartigkeiten, welche Ihre Figur unverwechselbar und schnell erkennbar machen.
1: Zeigen Sie die Einstellung Ihrer Figur zum Leben. Das vertieft Ihren Helden.
Читать дальше