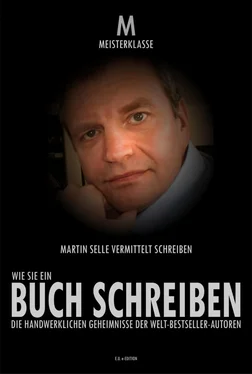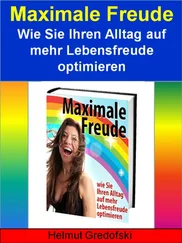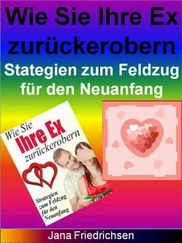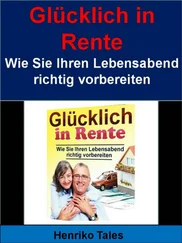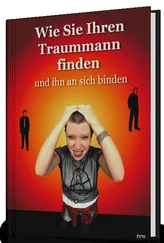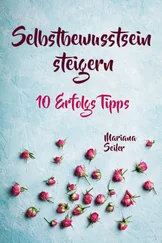Gerade wenn Sie dem Leser jene Seiten Ihres Helden zeigen, die er normalerweise vor anderen versteckt, dann bekommt der Leser das Gefühl, die Wahrheit über diese Figur zu erfahren. Lassen Sie den Leser immer im Glauben, dass er noch weitere Einblicke in das Seelenleben des Helden bekommt – bis zum Schluss der Geschichte. Auf diese Weise halten Sie den Leser in der Story.
Insider-Tipp: Achten Sie darauf, die negativen Eigenschaften des Helden nicht zu früh zu enthüllen, sonst kann sich der Leser ebenfalls nicht mit ihm identifizieren! Es ist wie im echten Leben: Der erste Eindruck entscheidet meistens über Sympathie oder Antipathie.
Lehnt der Leser Ihren Helden aufgrund der ersten Begegnung ab, können Sie diesen Sympathieverlust kaum noch aufholen. Zeigen Sie Ihren Helden daher beim ersten Auftritt in einer Szene, die ihn sympathisch macht: Der Held könnte in Gefahr sein (auf der Flucht vor jemandem), er erleidet unverschuldet ein Unglück (er weicht einem Betrunkenen aus und fährt sein neues Auto zu Schrott), er ist von negativen Kräften umgeben (Alex wurde gekidnappt), er befindet sich in einer verzweifelten Lage (zahle eine Million Dollar, oder du siehst deine Tochter nie wieder).
In ›Rocky‹ erleidet Rocky gleich zu Beginn im Boxkampf einen unfairen Kopfstoß. Der Leser ist sofort auf Rockys Seite, verbündet sich mit ihm. Wäre Rocky ein Gott ohne Schwächen, könnte ihm nie jemand einen derartigen Kopfstoß verpassen, er würde unwirklich wirken.
Sie könnten eine Szene schreiben, in der Helen ihren Ehemann Gerry, während dieser liebevoll ihre vierjährige Tochter Mary vom Kindergarten abholt, mit ihrem Chef betrügt. Sofort empfinden wir Helen und ihren Chef als unsympathisch, und Gerry ist unser Favorit.
Was den Leser und eine Figur unzertrennlich verbindet, ist das Hin und Her, das Auf und Ab der wechselnden Gefühle. Indem der Leser durch das, was dem Helden passiert, Gefühle erinnert, die er selbst kennt, verwischt sich die Grenze zwischen ihm und der Figur, zwischen Realität und fiktiver Geschichte – Leser und Figur verschmelzen miteinander.
Statten Sie Ihre Figuren demnach mit menschlichen Unzulänglichkeiten und Schwächen aus. Das erlaubt es dem Leser, Anteil zu nehmen am Schicksal der Figur. Er wird mit ihr leiden, weinen, lachen und kämpfen bis zum Schluss der Geschichte. Und genau das wollen Sie als Autor erreichen.
Die Königswege zur Bestsellerfigur
Nun haben wir schon eine ganze Menge über Figurencharakterisierung erfahren. Natürlich muss man einer Figur nicht einfach die ›knallrote Krawatte‹ verpassen, und das war es dann. Als Bestseller-Autor sind Sie daran interessiert, Ihre Figurenmerkmale professionell an den Leser zu bringen. Und wie Sie erahnen, gibt es auch dafür eine Handvoll bewährter Königswege der Profis. Diese Techniken stellen praktisch den Olymp des Figurencharakterisierens dar.
Königsweg 1: Darstellung durch Handlung
Erzählen Sie dem Leser nicht einfach, wie eine Figur aussieht, gekleidet ist, sich bewegt, zeigen Sie es ihm durch Handlung . Lassen Sie Ihre Figur aktiv etwas tun und sagen, anstatt mitzuteilen, was die Figur tut oder sagt. Man nennt diese Technik auch ›szenische Charakterisierung‹.
Der Vorteil dieser Meister-Technik besteht darin, dass Sie den Leser, indem Sie ihm den Helden in einer Aktion zeigen, sofort in die Welt der Geschichte hineinziehen. Ihr Held charakterisiert sich durch sein Verhalten, durch die Umgebung und durch die Reaktionen anderer Personen auf sein Tun. Dazwischen können Sie kurze ergänzende Sätze zum Aussehen und zur Vorgeschichte der Figur einflechten.
Sie war an die vierzig, schlank wie eine Gazelle und hatte ein kastanienbraunes Gesicht mit hellwachen, eiskalten Augen. Die breite Krempe ihres Strohhutes warf einen Schatten auf ihre Brillantohrringe, die im Licht der Südseesonne glitzerten. Sie trug einen gestreiften Bikini, dem man nicht ansah, dass er mehrere Hundert Dollar gekostet hatte.
Hier erfahren wir Genaueres über die Person (schlank wie eine Gazelle) und das Alter der Frau. Ebenso wichtige Details über ihr Gesicht. Vor allem, dass ihre Augen hellwach und eiskalt sind (unter der warmen Südseesonne), weisen deutlich auf Charakterzüge hin, wir ordnen diese Frau sofort einer ›gewissen Kategorie‹ zu. Bestimmt denkt der Leser nicht an eine Zeitungsverkäuferin. Die Brillantohrringe und der Ort, die Südsee lassen uns auf Reichtum schließen.
Oder dieses Beispiel:
»Wir schlagen los – jetzt sofort. Ich trau der Sache nicht!«, sagte Rick in seinem gewohnt gebrochenen Englisch.
Wir erfahren, dass ein Mann namens Rick ›losschlagen‹ will. Eine Handlung beginnt unmittelbar jetzt. Offenbar, so erfahren wir über Rick, ist er ungeduldig und misstrauisch. Es hat den Anschein, als müsse er mit jemandem zusammen einen Auftrag erledigen. Und er spricht ein gebrochenes Englisch, stammt also demnach aus einem anderen Land, Englisch scheint nicht seine Muttersprache zu sein.
Verwenden Sie also, vor allem am Anfang Ihrer Geschichte, zeigende, handelnde Techniken zur Charakterisierung. Beschreibende Techniken, die erzählen, behaupten, anstatt zu zeigen, um Figuren zu charakterisieren, wirken auf den Leser ermüdend, ziehen ihn nicht in die Welt Ihrer Geschichte tief hinein.
Jenny trug heute Turnschuhe, eine enge Jeans sowie ein gelbes T-Shirt und ihr Stirnband.
Leser unterscheiden Figuren aufgrund ihrer Handlungen, nicht dadurch, was Sie als Autor über die Figur berichten. Sagen Sie niemals, wie eine Figur ist, bringen Sie es durch Handeln der Figur zum Ausdruck. Sehen wir uns ein Beispiel an, wie wir eine Charaktereigenschaft einer Figur durch Handlung deutlich machen könnten:
Tobias war mehr als mutig.
Dieser Satz stellt eine bloße Behauptung des Autors dar. Uns wird mitgeteilt, dass Tobias mutig ist. Diese Form der Charakterisierung ist ungeschickt, sie berührt uns gefühlsmäßig nicht. Wie könnten wir bildhaft zum Ausdruck bringen, dass Tobias Mut besitzt:
Tobias stieg als Erster auf den morsch wirkenden Baumstamm. Schritt für Schritt tasteten sich seine nackten Füße vorwärts. Ich wurde nur vom Zusehen fast wahnsinnig. Die Schlucht unter ihm musste mindestens hundert Meter tief sein − und nur Felsen!
Diese Beschreibung von Tobias’ Mut ist gelungener, weil der Leser die Eigenschaft sieht . Tobias wird durch eine Handlung charakterisiert, die seine Tapferkeit zum Ausdruck bringt. Natürlich sollte das Bild, mit dem Sie Tobias’ Mut zeigen, inhaltlich zur Geschichte passen. In Tobias’ Fall könnte es sich um eine Pfadfindergeschichte handeln. Noch ein Beispiel: das ängstliche Kind. Wir erklären nicht, dass das Kind Angst hat, wir zeigen es durch Handlung:
Sämtliche Lichter in dem unheimlichen Haus erloschen auf einen Schlag. Sarah sah nicht einmal mehr ihre Hand vor den Augen. Instinktiv wich sie zurück, presste ihren Rücken gegen die Wand und rutschte zu Boden. Zitternd kauerte sie sich in die Ecke und lauschte auf das nahende Geräusch.
Die Technik besteht also darin, Charaktereigenschaften, wie eine Person ist, durch Handlung darzustellen und dem Leser nicht einfach nur mitzuteilen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Suchen Sie nach geeigneten Bildern, die Eigenschaften zeigen. Ihre Fantasie wird Ihnen dabei helfen.
Königsweg 2: Darstellung durch Überzeichnung
Das Überzeichnen oder Übertreiben von Eigenschaften ist eine hervorragende Technik der Charakterbeschreibung. Denken Sie in diesem Zusammenhang an Karikaturisten, die den Erkennungseffekt von Personen, die sie mit nur wenigen Strichen darstellen, erreichen, indem sie ein oder zwei markante Körperteile überzeichnen, also übertrieben deutlich zum Ausdruck bringen. Da reichen die große krumme Nase, die extrem abstehenden Ohren oder die weit vorstehenden Zähne. Sofort wissen wir, wer gemeint ist.
Читать дальше