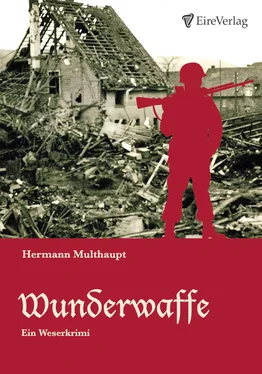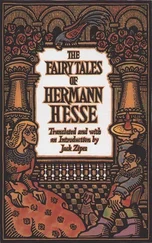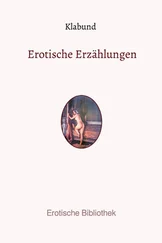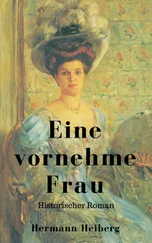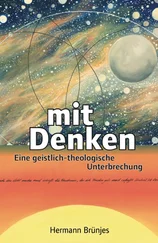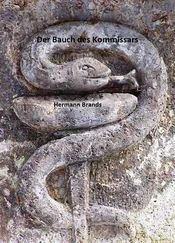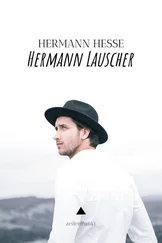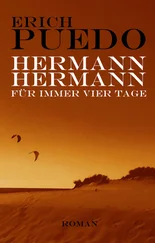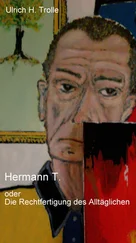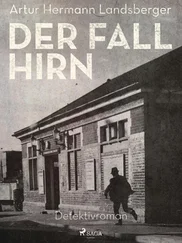Antonie war vor allem den Frauen ein Ärgernis: Weil sie sich „schön machte“ und schminkte, nach der letzten Mode kleidete, sofern in diesen Kriegstagen überhaupt neue Kleidung auf den Markt kam, und damit gern auf der Dorfpromenade einherstolzierte. Nein, diesen Fummel konnten sich die einheimischen Frauen nicht leisten. Antonies Kommentar war gleichfalls nicht auf Aussöhnung angelegt: „Die laufen herum in Sack und Asche.“
Die wechselnden Militärs am Ort gingen dem Kriegskreisleiter aus dem Wege. Außer der vorgeschriebenen Begrüßung enthielten sie sich jeden weiteren Kommentars. Mancher hatte das Gefühl, dass der „Braune“, wie sie ihn nannten, froh war, wenn die Soldaten wieder abzogen.
Gerda, die Hausangestellte, die sonst während der Saison als Zimmermädchen arbeitete, durfte nur jeden zweiten Tag und stets in Anwesenheit des Gastes das Bett aufschütteln oder den Papierkorb leeren. Staubwischen war auf ein Mindestmaß beschränkt. Es war offensichtlich, der Kriegskreisleiter wollte, nein, musste allein sein, um an den Plänen für den Endsieg zu arbeiten …
„Der Feind zwingt uns dazu, unsere Pflicht dezentralisiert zu tun“, erklärte er einmal, nachdem er drei Schoppen „Pfälzer Roten“ auf Kosten des Hauses genossen hatte. „Wir haben die Büros aufgelöst, weil sie, wie alles, was deutsch ist, das Ziel der angloamerikanischen Flugzeuge sind. Dennoch arbeiten wir effektiv. Wir sind durch Kuriere miteinander verbunden. Die Kradfahrer kommen anonym. Wir treffen uns kurz an verschiedenen Plätzen zum Informationsaustausch. Sie werden kaum etwas mitbekommen. Den Fernsprecher benutzen wir nicht, Sie wissen, Herr Wirt: Feind hört mit!“
Wirt Engelhardt legte sich zweimal auf die Lauer – einen Kradfahrer entdeckte er nicht. Auch versuchte er einmal heimlich, den Inhalt des Papierkorbes vor der Entleerung in die Weser zu inspizieren, was der Gast stets persönlich besorgte; vergeblich. Er fand nur Schnipsel mit Zahlen vor, auf die er sich keinen Reim machen konnte. Allerdings verließ Müller einige Male spätabends das Haus – zum Spaziergang, wie er sagte. Engelhardt war zu müde, um ihm nachzuschleichen.
Zwei, drei Wochen vergingen. Der Tag des Kriegskreisleiters brachte nur wenig Änderung in inzwischen eingespielte Gewohnheiten. Einige Male suchte er das Postamt auf, um eingeschriebene Briefe zu expedieren. So hinterlistig einige Dorfbewohner auch darauf drangen, die Empfänger der Nazi-Botschaften in Erfahrung zu bringen – die Beamtin, eine säuerliche Jungfer, deren Verlobter im Ersten Weltkrieg gefallen war, hielt sich an ihre Diskretionspflicht und beantwortete die Fragerei mit mürrischem Schweigen. Sie hatte ohnedies nur Tarnadressen vor sich. Einige Male verfolgte der Kriegskreisleiter auch die Luftlagemeldungen im Büro des Femewirtes; dort stand das Radio, das über Feindeinflüge ins Reich informierte.
„Das ist eine zwiespältige Sache“, meinte er einmal. „Die feindlichen Verbände können die Funkwellen als Orientierungshilfe nutzen.“
Er war äußerst zufrieden, wenn die Sender vorübergehend den Sendebetrieb über Funk einstellten und zum Drahtfunk übergingen, dessen Mitteilungen über das Telefon kamen.
Als Bürgermeister Haferstroh dem hohen Partei-Bonzen seine Aufwartung machen und ihn im Namen der Dorfgemeinschaft begrüßen wollte, erhielt er eine Abfuhr. Wichtige Geschäfte hinderten ihn, den Bürgermeister persönlich zu empfangen, ließ der Kriegskreisleiter dem im Gastraum wartenden Dorfoberhaupt mitteilen, er danke jedoch für die Aufmerksamkeit. „Heil Hitler!“
Einmal nahm Müller die Hausangestellte Gerda beiseite.
„Mich wundert“, sagte er, „dass ein so fesches Mädel wie Sie hier in einem abgelegenen Gasthof Dienst tut. Haben Sie nie nach Höherem gestrebt?“
„Was nennen Sie denn Höheres, Herr Kriegskreisleiter?“
„Nun hören Sie mal!“, fuhr Müller auf, „das mindeste wäre doch eine Funktion in der NS-Frauenschaft , wenn Sie die Zeit für eine Tätigkeit im Bund Deutscher Mädel schon verschlafen haben.“
„Verschlafen?“ Gerda holte tief Luft. „Ich habe nichts verschlafen. Ich bin nur geradezu immer in Deckung gegangen, wenn etwas auf mich zukam, das ich nicht wollte.“
Kriegskreisleiter Müller stemmte die Fäuste in die Seite. „Was soll das! Das müssen Sie mir erklären!“
Gerda lehnte sich an das Treppengeländer, als handele es sich um eine leichte, erfrischende Konversation.
„Der Gedanke, zu heiraten, ist mir noch nicht gekommen. Dann müsste ich dem Führer ja ein Kind schenken, eins für den Krieg oder eins für den BDM oder die Frauenschaft oder weiß der Kuckuck für wen. Mir macht die Arbeit hier Spaß und ich bin zufrieden.“
Müller lag eine harsche Erwiderung auf den Lippen, doch er sagte nichts, sah Gerda nur wütend an und stapfte wutschnaubend in seine Zimmer hinauf. Gerda war eine entfernte Verwandte Engelhardts. Sie hatte den Gymnasialbesuch abbrechen müssen, um zur finanziellen Versorgung ihrer kranken Mutter beizutragen. Ihr Vater, ein lutherischer Pfarrer, war wegen regimekritischer Predigten ins KZ Dachau eingeliefert worden. Er hatte beispielhaft von einem Grubenunglück in Frankreich erzählt, bei dem eine Schicht von Bergleuten eingeschlossen worden war. Die französische Seite verfügte nicht über die Rettungsmaßnahmen, die die deutsche Seite bereits besaß. Der Schlagbaum hinderte einen freien Grenzverkehr. Man stellte sich vor, wie sich die Angehörigen am Schacht versammelten und nach ihren Angehörigen fragten, wie Mütter um ihre Söhne, Frauen um ihre Männer bangten. Da entschlossen sich die deutschen Kumpels, den französischen Kollegen zur Hilfe zu kommen. „Wir Bergleute holen sie da heraus!“, entschieden sie, und vollzogen einen Akt der Menschlichkeit, der ihnen Sympathien, dem Prediger jedoch bei der Parteizentrale Ärger und die Einlieferung ins Konzentrationslager einbrachte.
Gerda hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, schüttelte den Kopf und zog sich in die Küche zurück.

Die Tage waren schon herbstlich. Die Bäume färbten sich, unberührt von den kriegerischen Ereignissen in ihrem Umfeld, wie alle Jahre. Die Natur hielt ihren Lebensrhythmus ein. Die Luft war klar. Fliegerwetter. Was das bedeutete, wussten alle. Wer nicht unbedingt mit dem Zug fahren musste, vermied die Reise. Die Gefahr, durch Tieffliegerbeschuss sein Leben zu riskieren, wuchs mit jedem Tag. Die Schülerinnen und Schüler, die auf den Transport mit der Eisenbahn angewiesen waren, nahmen manchmal den Frühzug, bevor es richtig hell wurde, und kamen erst zurück, wenn die Dämmerung hereingebrochen war. Viel Zeit für die Schularbeiten blieb dann nicht mehr, zumal eine Reihe von ihnen noch die Kühe melken oder im Haushalt helfen musste.
Fliegerwetter!
„Musst du heute wieder auf den Zug?“
In Hembsen räumte Elisabeth Hillebrand das Frühstücksgeschirr in den Schrank und sah ihren Mann besorgt an.
„Wo kann ein Lokomotivheizer sonst schon Dienst tun? Meinst du, man schickt mich auf ein Schreibbüro, weil es dort sicherer ist? Wie viele Bahnhofsgebäude liegen schon in Schutt und Asche. Auf der Lok kann man nötigenfalls noch ausweichen.“
„Ausweichen? Wohin willst du da denn ausweichen, wenn die Jabos dich ausgeguckt haben?“
Hillebrand packte die Thermoskanne und ein paar Stullen in die Aktentasche. „Man kann abspringen, unter einen Wagen kriechen. Und wenn man einen Tunnel vor Augen hat, kann man mitsamt dem Zug im Loch verschwinden.“
„So, so. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass du noch eine Chance hättest, wenn die Bordkanonen knallen. Wie ist es denn deinem Kollegen Anton Winter aus Brakel ergangen? Wurde von einem Leuchtspurgeschoss an der rechten Ferse getroffen. Wer ahnte denn, dass der Phosphor erst nach vierzehn Tagen seine tödliche Wirkung bringt?“
Читать дальше