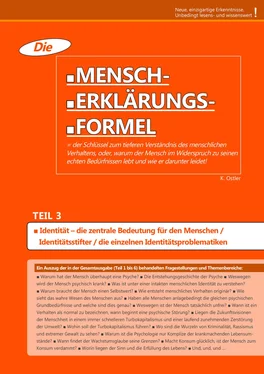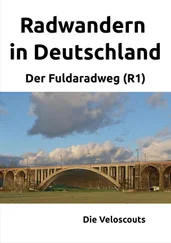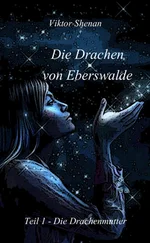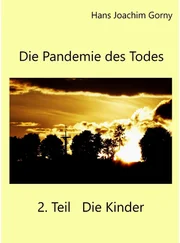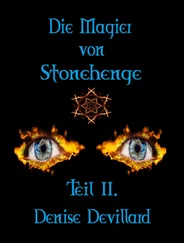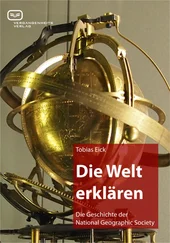Mit anderen Worten: In diesem Fall wird Energie erzeugt und angereichert und steht darüber hinaus im genügenden Maße den nachfolgenden Entwicklungsschritten zur Verfügung, im gegensätzlichen Verlauf (je nach genauer Ausprägung) würde die Basisenergie, das Energiereservoir, welches jeder Mensch in einem gewissen Umfang hat (energetisches Startkapital aus dem Überlebenstrieb gespeist), angegriffen, neue Energie nur unzureichend geschaffen und viel Energie für energieintensive Ersatz- und Kompensationshandlungen verbraucht bzw. gebunden werden. Die laut menschlicher Bauplan weiteren Entwicklungsschritte können lediglich im limitierten Ausmaß vollzogen werden, eine psychische Problematik manifestiert sich.
Dieser Prozess ist äußerst dynamisch. Das heißt, dass Reize laufend einströmen, je nach dem aktuellen Stand der psychischen Struktur und des entsprechenden entwicklungspsychologischen Zeitfensters bewertet werden, daher direkt auf die vorhandene psychische Struktur einwirken und diese modulieren, nachfolgende Reize werden bereits gemäß der sich veränderten Struktur beurteilt, usw.
Gleichzeitig dazu werden die Gefühle permanent an den jeweiligen Reiz und die jeweilige Qualität der psychischen Struktur angepasst und wiederum das darauf basierende Verhalten initiiert.
Dieser Ablauf, der während der ersten Lebensjahre hochdynamisch ist, verliert mit der Schließung der entwicklungspsychologischen Zeitfenster (laut menschlichen Bauplan vorgegebene Zeiträume, innerhalb deren bestimmte Entwicklungsschritte vollzogen werden müssen, um die Funktionsfähigkeit angemessen zu erhöhen; Stichwort: Reifungsprozess) an Kraft, weil sich mit der Zeit ein in seiner Konsistenz nahezu unabänderliches psychisches Fundament geformt hat. Dieses hat entweder viel Lebensenergie/Selbstwert gespeichert und ist somit stabil und sicher, oder es leidet an Energiemangel/Selbstwertdefizit, ist demnach instabil und unsicher, und Ausgangspunkt für energieintensive Kompensationen, Ersatzhandlungen, Verdrängungen, psychische Reaktionen, etc.
Anders formuliert: Angesichts des bestehenden, relativ konstanten psychischen Grundgebildes, das sich im hohen Maße durch die sich individuell modellierte Ersatzhandlungs-/Kompensations- und Verdrängungsstruktur definiert, treffen Reize nicht mehr auf eine sich stets und verhältnismäßig schnell wandelnde, sich noch in der Entwicklung befindlichen Basis. Die Folge ist, dass der Gefühlsablauf – außer bei speziellen psychischen Krankheitsformen wie beispielsweise der bipolaren Störung – ziemlich beständig bzw. gleichförmig ist, da die Reizbewertungen keinen erheblichen Schwankungen unterliegen und deshalb die Gefühlsschwankungsbreite ebenso reduziert ist.
Kategorisierung der Gefühlsausprägungen – was soll die jeweilige Gefühlsart ausdrücken?
Gibt es eine Unterscheidung in echte, wahre und, im Gegensatz dazu, in unechte, künstliche Gefühle oder ist diese unzutreffend?
Auf den ersten Blick scheint eine Einteilung der mannigfachen Gefühlsausprägungen ein einfaches Unterfangen zu sein, sofern allerdings in der Betrachtung der Fokus auf die identitätsgemäßen Mechanismen gelegt wird, erweist es sich als sehr komplex.
Generell kann festgestellt werden, dass elementare Gefühle, auch als Basis- bzw. Primärgefühle zu bezeichnen, immer in Verbindung zur identitäts-/selbstwertgemäßen Grundproblematik, zu den ausreichend zu befriedigenden psychischen Grundbedürfnissen und zum Überlebenstrieb des Menschen stehen. Aus den Primärgefühlen lassen sich viele weitere Mischformen ableiten, deren Grundlage jeweils auf dem Primärgefühl beruht.
Wenn eine Person sich agil, aktiv, akzeptiert, angenommen, ausgeglichen, aggressiv, alleine, angespannt, ängstlich, antriebslos, apathisch, ärgerlich, ausgelaugt, aufgeregt, ausgeliefert, ausgestoßen, ausgelaugt, beflügelt, bestätigt, beklommen, bekümmert, belastet, betrogen, betrübt, depressiv, deprimiert, düster, energiegeladen, enthusiastisch, entspannt, erfrischt, erleichtert, eifersüchtig, einsam, energielos, ekelerfüllt, entmutigt, enttäuscht, entwertet, erledigt, erniedrigt, erregt, erschöpft, erschüttert, erstarrt, frei, friedlich, fröhlich, freundlos, friedlos, frustriert, gedemütigt, gefangen, gehemmt, geknickt, gelähmt, genervt, gereizt, gestresst, hasserfüllt, geborgen, gelassen, geliebt, gelöst, glücklich, gut, hilflos, hoffnungslos, hoffnungsvoll, inspiriert, instabil, jämmerlich, klar, kraftvoll, kaputt, konsterniert, kraftlos, kummervoll, labil, leblos, leer, lethargisch, lebendig, lebensfreudig, leicht, leidend, locker, lustvoll, lustlos, mächtig, machtvoll, melancholisch, minderwertig, missmutig, motiviert, mutig, müde, mürrisch, mutlos, negativ, nervös, niedergeschlagen, nutzlos, offen, optimistisch, orientierungslos, panisch, passiv, pessimistisch, phlegmatisch, positiv, rastlos, resigniert, ruhelos, ruhig, schwungvoll, selbstbewusst, selbstsicher, sicher, sorgenfrei, stark, stressfrei, schlecht, schutzlos, schwach, schwer, schwermütig, schuldig, tatkräftig, tot, träge, traurig, trübsinnig, überfordert, unbekümmert, unbelastet, unbeschwert, überlastet, unausgeglichen, unglücklich, unruhig, unsicher, unterlegen, unverstanden, unwohl, unzufrieden, verängstigt, verbittert, verkrampft, verletzbar, verletzt, verloren, verspannt, verstört, verunsichert, verstanden, verzaubert, verzagt, verzweifelt, wohl, wütend, zaghaft, zermürbt, zerrissen, ziellos, zornig, zurückgezogen, zweifelnd, wach, zufrieden, zugehörig, zuversichtlich fühlt bzw. ist, dann hat dies direkt/unmittelbar oder indirekt/mittelbar mit der identitätsgemäßen Verfassung zutun, die sich unter anderem aus der individuellen Sozialisation und den konkreten Lebensumständen (siehe die Identitätsproblematiken 2 bis 4) zusammensetzt.
Dies bedeutet, dass zum Beispiel von einer Schlange für einen Menschen aus den westlichen Ländern ein Gefühl der Angst entfacht wird, während ein im brasilianischen Urwald lebender Mensch beim Anblick der Schlange keine Angst empfindet.
Oder sehr unterschiedliche Essgewohnheiten, die bei einem, beispielsweise beim Verzehr von Insekten, Ekelgefühle, beim anderen Appetit hervorrufen.
Ein anderes, krasses Beispiel: Ein Kind, welches in einem Bürgerkriegsgebiet mit vielen, sichtbaren Opfern aufwächst, hat mit der Zeit beim Anblick eines per Gewalt entstellten Menschen nicht die schockierten Gefühle, wie ein Mensch, dessen Alltag friedlich verläuft.
Hier müssen Vorfälle existenzieller Natur eine besondere Erwähnung finden, zum Beispiel ein Todesfall oder ein schwerer Unfall einer nahestehenden Person, der Gefühle des Leides, des Schmerzes, der Trauer, der Resignation, der Perspektivlosigkeit, der Starre, etc. auslöst und die Handlungsfähigkeit des betroffenen Menschen teilweise erheblich einschränkt.
Auch in diesen Fällen, die nichts unmittelbar mit dem Werdegang eines Menschen und dessen psychischer Situation zu tun haben, spielt die identitätsgemäße Konstellation eine überaus bedeutende Rolle. Bei vorhandener individueller psychischer Stabilität und Autonomie kann ein Betroffener mit plötzlichen Schicksalsschlägen oder anderen, unerwarteten oder zu erwarteten belastenden Ereignissen leichter umgehen und diese besser wie zudem schneller verarbeiten, um derart seine Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Soweit sind die Ausführungen und Kontexte leicht nachvollziehbar.
Wenn jedoch die Primärgefühle in echte/wahre und unechte/künstliche Gefühle bzw. in vorder- und hintergründige Gefühle zu differenzieren sind, und diese ferner in Beziehung zu den ursprünglichen Gefühlserwartungen mit Berücksichtigung der entwicklungspsychologischen Zeitfenster gesetzt werden, dann gestaltet sich die Erklärung deutlich vielschichtiger.
Die multidimensionalen Zusammenhänge sind am besten an einem Fallbeispiel zu veranschaulichen, nämlich der Beziehungsangst- bzw. Angst vor Nähe-Problematik.
Читать дальше