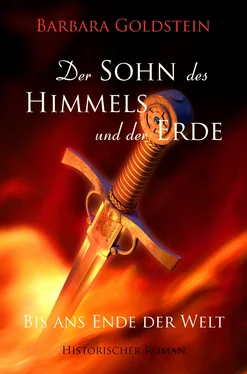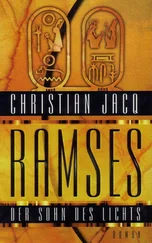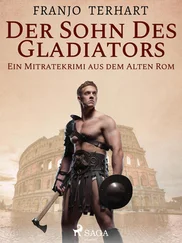»Und wo ist es jetzt?«, fragte er.
Ich deutete auf die Pferdeweide, wo über dem Grab das erste blaugrüne Gras zu sprießen begann.
Mukali schloss die Augen zu einem kurzen Gebet zum Himmel. Er nahm wohl an, dass mein Bruder sein Sohn gewesen war. Ich tat nichts, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
In jener Nacht fügte sich Mukali dem Willen meiner Mutter und schlief vor unserer Jurte. Noch nach Mitternacht hörte ich ihn draußen sich unruhig auf seiner Schlafdecke wälzen. Er dachte wohl an seinen Sohn, den er nie kennen gelernt hatte.
Leise stand ich auf und schleppte meine Filzdecke neben Mukalis Schlafplatz. Er hatte mich kommen gehört, hob die Decke und ließ mich neben sich unter das Fell kriechen. Eng aneinander geschmiegt schliefen wir, bis meine Mutter das Zelt verließ, um Teewasser zu holen.
In der nächsten Nacht kam Mukali gegen Mitternacht in unsere Jurte. Ich hörte ihn sein Fell hereinschleppen und neben Mutters Schlafmatte ausbreiten. Dann legte er sich neben sie ohne sie zu wecken und verbrachte den Rest der Nacht in der Nähe des Feuers. Es dauerte fünf Nächte, bis sie ihn unter ihre Decke ließ.
Mukali blieb drei Wochen bei uns, denn zum Frühlingsfest wurde er in seinem Ordu zurückerwartet. Zum Abschied schenkte er mir seinen Sattel, der mit Silber verziert war. Er ging von uns, ohne von meiner Mutter die erwartete Antwort erhalten zu haben.
Der Frühling ging unmerklich in den Sommer über, der in diesem Jahr der Ratte (1192) sehr kühl war. Es regnete fast ununterbrochen und die Steppe verwandelte sich in einen Sumpf.
Von der Welt außerhalb unseres Ordu hörten wir fast nichts, da nur wenige Boten im Schlamm des Sommers unterwegs waren. Wir hörten nur von einem Überfall auf ein Lager der Dschurkin. Wir konnten aber nicht herausbekommen, wessen Lager überfallen worden war. Mukali hatte versprochen, im Sommer wiederzukommen, aber er kam nicht und so begannen Mutter und ich zu fürchten, dass sein Lager vernichtet worden war. Ich beruhigte sie mit den Worten, dass das Reisen während der unablässigen Regenfälle und der Überschwemmung der Flüsse nicht möglich war.
Der Sommer flog vorüber wie ein Falke, der Beute erspäht hat. Sobald der Boden trocken war und das Gras sich aufgerichtet hatte, setzte der erste Frost ein. Im neunten Mond hatten wir den ersten Schneesturm, im zehnten Mond lag der Schnee so hoch wie noch nie. Gerade noch rechtzeitig hatten wir das Herbstlager erreicht und unsere Vorräte für den langen Winter vorbereitet.
In diesem Jahr überwinterte ein chinesischer Händler in unserem Ordu. Der frühe Schnee hatte ihn und seine Karawane überrascht, als er vom Lager des Khan nach Süden ziehen wollte. Bis zum ersten Schnee hatte er mit seinen Begleitern die Grenze der Gobi erreichen wollen. Ich half ihm, die Lastkamele zu entladen. Meine Mutter zeigte sich den Chinesen gegenüber gastfreundlich und ließ sie in Kökschus Jurte schlafen, die wir innerhalb einer Stunde in dichtestem Schneetreiben errichtet hatten.
Der Chin war umsichtig genug, für unsere Hilfe großzügig zu bezahlen. Er schenkte uns ein Teegeschirr mit zehn gleichen Tassen. Ich wusste zwar nicht, was wir mit so vielen Trinkschalen anfangen sollten, aber wir nahmen sein Geschenk an. Ich fragte den Chin, der unsere Sprache leidlich gut sprach, nach der großen Zahl der Tassen, die alle gleich aussahen und er erklärte mir, dass das Geschirr in einer Manufaktur hergestellt wurde. Und er erzählte mir noch viele andere erstaunliche Dinge aus Chin. Dass die Chin mehrmals im Mond badeten und ihren Körper mit Duftwasser einrieben, um nicht nach sich selbst zu riechen. Dass die Chin nicht auf dem Boden schliefen, sondern auf Holzgestellen und weichen Matratzen. Dass die Chin Krankheiten mit Nadeln heilen konnten, die sie in die Haut des Kranken bohrten. Dass das Reich Chin in verschiedene Provinzen aufgeteilt war, von denen jede einzelne größer war als der gesamte Mongol Ulus, von dem der Khan träumte. Und dass das riesige Reich von einem Kaiser in Zhongdu beherrscht wurde, der sich Sohn des Himmels nannte. Und dass dieser mächtige Kaiser über mehr Beamte verfügte, als das Volk der Mongol Menschen zählte. Ich war beeindruckt.
Dem Chin schmeichelte mein Wissensdurst. Er bezeichnete mich als einen Schwamm, der alles Wissen in sich aufsaugt. Als ich ihn fragte, was ein Schwamm sei, lachte er. Als er mir zeigte, wie man mit den hölzernen Essstäbchen aus Chin umging, fragte ich: »Warum isst man mit Stäbchen, wenn das Fleisch doch herunterfällt, wenn man es nicht vorher klein schneidet?« Als er mir eine Schriftrolle zeigte, die über und über mit Strichen und Punkten bedeckt war, fragte ich: »Wozu muss man lesen und schreiben können, wenn man keine Bücher besitzt?« Aber als er begann, mir ein paar Worte seiner Sprache beizubringen, fragte ich ihn nicht, wozu ich sie lernen sollte. Ich wusste es. Ich wollte nach Chin reisen. Ich wollte mir all das ansehen, von dem der Händler mir erzählt hatte. Irgendwann.
Den ganzen Winter über ritt ich zur Jagd, wenn Schnee und Kälte es zuließen. Der Chin-Händler tauschte seine gesamten Waren gegen schöne Pelze ein. Ich schleppte ihm Dutzende von Hermelin- und Fuchspelzen an, die im zweiten und dritten Wintermond besonders dicht und schimmernd waren, und erhielt dafür so exotische Dinge wie ein Schreibset, bestehend aus einem Pinsel mit langen Marderhaaren, einem Tintenfass, einem schwarzen Tintenstein und einer Rolle Reispapier. Ich konnte zwar nicht schreiben, aber ich wollte den Pinsel und das Papier besitzen. Außerdem tauschte ich mehrere Ballen Seidenstoff ein, damit meine Mutter uns neue Deels daraus fertigen konnte. Für meine Mutter erwarb ich einen großen Kupferkessel, schwarzes Schminkpulver für die Augen und einen Kamm aus Elefantenzahn. Ich musste den Händler mit großen Augen angesehen haben, als er mir beschrieb, wie ein Elefant aussah.
Noch vor der Schneeschmelze des Büffeljahres (1193) verabschiedeten sich der Chin-Händler und seine Begleiter und zogen mit ihrer Lastkarawane weiter nach Süden. Ich wäre gerne ein Stück mit ihnen geritten, denn die geheimnisvollen Worte des Händlers hatten mich neugierig gemacht. Auf Chin. Und auf alle Länder jenseits des Horizonts.
Der Sommer war lang und trocken und heiß. Die Pferde und Yaks gediehen prächtig. Die Schafe und Ziegen weideten schnell das trockene Gras ab, sodass wir in diesem Jahr früh ins Herbstlager umzogen, wo wir nur zwei Monde blieben, um erneut weiterzuziehen. Das Winterlager schlugen wir weit im Süden auf und hofften auf einen milderen Winter als im letzten Jahr. Meine Mutter und ich bereiteten uns auf eine lange Schneezeit vor, sammelten Dung und Heu, schlugen Airag und Arkhi, bauten einen Pferch für die kleinen Tiere und schlugen Kökschus Jurte auf, um in den kältesten Schneenächten die Lämmer und Zicklein dort unterzubringen.
Trotz aller Vorbereitungen wollte der Winter noch nicht kommen. Im elften Mond hatte es noch immer nicht geschneit. Es war zwar so kalt, dass ich meine neue Dacha aus Wolfspelz über die seidene Deel zog und mir auch meine Malgaj aufsetzte, aber es war nicht Winter .
Kurz vor Tsagaan Sar kam die Kälte dann mit aller Macht. Über Nacht begann es in dicken Flocken zu schneien und hörte bis zum Ende des ersten Mondes nicht mehr auf. Es war nicht so kalt wie in den Wintern zuvor, aber dafür lag der Schnee so hoch, dass die Pferde und die Yaks tief nach gefrorenem Gras graben mussten.
Im zweiten Mond stand der Schnee so hoch, dass unsere beiden Jurten nur noch aus einem Dach zu bestehen schienen. Immer wieder musste ich den Schnee vom Filz herunterfegen, obwohl er den Innenraum gut isolierte. Aber die Schneelast war zu schwer und drohte das leichtgebaute Holzgestell der Jurte zu zerdrücken.
Die Katastrophe begann im dritten Mond und endete erst kurz vor dem Frühlingsfest. Die ersten Frühlingsstürme brachten den Sand der Gobi bis zu uns und färbten den Schnee vor unserer Jurte rostrot. Ich wusste, was das bedeutete. Es würde ein warmer Frühling werden, die Schneemassen schmolzen innerhalb von wenigen Tagen, die Flüsse schüttelten ihre Eisschollen ab wie ein Wolf seinen eisbedeckten Pelz. Für drei Wochen war die Steppe überschwemmt und das Schmelzwasser sammelte sich in den Senken, sodass unser Ordu von einer in der Sonne glitzernden Seenlandschaft umgeben war. Es war ein herrlicher Anblick.
Читать дальше