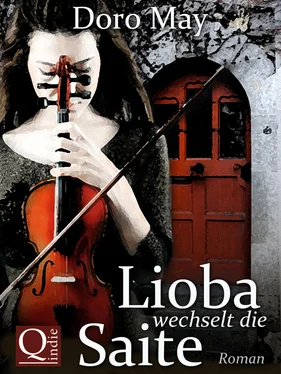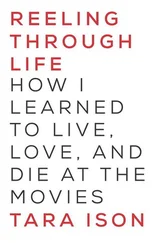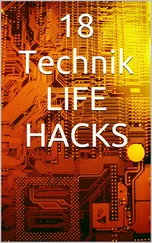„Du hast einen Kühlschrank?“, sagt Erasmus spöttisch.
„Wen bringen wir eigentlich unter die Erde?“, wendet sich die blonde Langmähnige, die an eine Meerjungfrau erinnert, an den Mönch.
„Du meinst, unter die Wurzel? Einen eingefleischten Fan, wen sonst?“ Samuel, der die Fidel streicht, wundert sich über sich selber. Ja, er kann wieder witzeln. Länger schon. Erasmus ist es ebenfalls aufgefallen, denn er lächelt zu ihm hinüber. Wussten die anderen eigentlich, dass sie alle seine Familie waren? Nicht mehr und nicht weniger. Die Szene ist eigentlich Nebensache. Obwohl... . Vielleicht doch nicht. Im städtischen Orchester hat er sich zunehmend gelangweilt. Außerdem hatte er es nicht ertragen können, dass Elisabeth nach der Vorstellung nicht mehr auf ihn wartete. Sollten sie ihn doch ruhig für bescheuert erklären. Vor allem der Bratschist. Samuel muss grinsen. Dieser Affe. Wie der sich aufgespielt hat, als Samuel verkündete, er habe sich beruflich verändert, und als er dann mit der Wahrheit rausrückte. Absturz aus dem klassischen Olymp ins Bettelpack. Der Bratschist hatte im Grunde nur ausgesprochen, was die anderen dachten. Jedenfalls hat Samuel das allgemeine Kopfschütteln noch vor Augen.
Der dicke Mönch sagt: „Die Tote ist eine Bürgerliche aus der Jetztzeit. Sie hatte Krebs, die Arme. Und es war ihr Wunsch, von den Fährfrauen begleitet zu werden und wir sollen den Schlusspunkt setzen. Weil das Leben doch weitergeht und lustig sein soll.“
„Und was tun die Fährfrauen hier, wo wir doch engagiert sind?“ Erasmus hat einen etwas beleidigten Ton angeschnitten. Man merkt, dass er sich nach einer richtigen Bühne sehnt. Damit kennt er sich aus. Aber das hier...
„Die Seele hat es nicht so eilig, weißt du“, erklärt ihm Hildegard mit Geduldsstimme, „da freut sie sich, wenn sie zum endgültigen Abschied ein bisschen Begleitung hat.“
„Wer? Die Seele?“
„Ja klar. Davon reden wir doch gerade, oder?“ Sie sieht Erasmus an wie eine genervte Mutter.
„Und was macht die Seele, wenn der Tote als Organspender zerlegt wird?“, fragt Erasmus.
„Das muss für eine Seele fürchterlich sein.“ Hildegard senkt die Stimme. „Früher haben sie drei Tage lang den Toten aufgebahrt, ihm vorgelesen, waren bei ihm, haben für ihn gebetet. Das Fenster stand offen. Da konnte die Seele dann raus, wenn ihr danach war.“
„Nee, ne?“ Erasmus gibt den dummen Schüler, der seiner Lehrerin den Unsinn nicht abkaufen mag.
„Glaub doch, was du willst. Ich lasse mich jedenfalls nicht zerteilen“, sagt Hildegard.
„Ist ja in Ordnung“, zischt Erasmus. „Wenn du gestorben bist, les ich dir also drei mal 24 Stunden vor und spiel dir paar von unseren Liedern und das Fenster mach ich auch auf. Dann kann deine Seele ungestört abhauen. Bist du nun zufrieden?“
Ein älterer Mann tritt zu der mittelalterlichen Band, so dass Hildegard die Antwort schuldig bleibt. Als er in dem grauen Wetter die Sonnenbrille abnimmt, werden gerötete Augen frei. Hinter ihm geht eine weiß gekleidete Frauengruppe, eine Melodie summend. Es klingt harmonisch warm und auf eine angenehme Weise feierlich. Eine der Frauen, die ausstrahlen, dass sie genau wissen, was zu tun ist, trägt eine Urne in den ein wenig vorgestreckten Händen.
„Schön, dass Sie kommen konnten“, sagt der Witwer zu Bonifacius, dem als Mönch verkleideten Bandleader. „Meine Frau war sehr dem Mittelalter verbunden, müssen Sie wissen. Sie hatte Mediävistik studiert und interessierte sich besonders für das mittelalterliche Liedgut. Diese zuweilen recht deftige Musik hatte es ihr angetan.“ Er zwingt sich zu einem Lächeln.
Bonifacius macht eine Geste, als wolle er den Mann umarmen. Stattdessen legt er seine Arme um die riesige Trommel vor seinem Bauch, was ihn in Samuels Augen irgendwie lächerlich erscheinen lässt. Kummer tötet leider nicht, denkt Samuel und blickt mitleidig auf den Mann. Nur endlose Müdigkeit kommt und geht, wie es ihr gefällt. Und dass einem bald alles gleichgültig wird, was einmal von Bedeutung war. Vor seinem inneren Auge ist er es, der hinter dem Sarg einer Frau hergeht. Seiner Frau. Es ist bald zwei Jahre her.
Die Fährfrauen, die sich eigens dazu zusammengefunden haben, die Toten auf ihrer letzten Reise zu begleiten, ziehen an den Wartenden vorbei. Hinter ihnen geht jetzt der Witwer, dem ein Trauerzug von etwa dreißig Leuten folgt. Die Mittelalterlichen bilden den Schluss. Im Vergleich zu den in feinem Schwarz gekleideten Trauergästen und den weißen Fährfrauen wirken sie wie Lumpengesindel, das sich hinterher schleicht, um zu sehen, was vom Leichenschmaus für sie abfällt.
Vielleicht besuche ich nachher Sina, überlegt Samuel. Sie gab sich von Anfang an, als sie in die mittelalterliche Subkultur hineinplatzte, als Baderin aus. Natürlich weiß jeder, der auf der Eyneburg mitmacht, dass sie den Männern nicht nur den Rücken schrubbte. Sie empfindet ein besonderes Glück beim Körperkontakt und wird weich wie Butter, sobald jemand seinen Kummer bei ihr ablädt. Als Elisabeth tot war, endlich, nachdem die Quälerei unerträglich geworden war, da hatte er sich in ihr verkrochen. Sina hatte keine Fragen gestellt und nicht von der Zukunft geredet. Die Leute aus der Szene wollen sie wohl eher weghaben. Die Frauen vor allem.
Es ist Samuel gleichgültig.
Die Partnerbörse und warum sich Lioba wieder davon abwendet
Völlig nackt steht Lioba auf einer Bank vor dem Aachener Hauptbahnhof und ruft in die Menge: „Wer will mich?“ Alle glotzen sie an, doch keiner schreit „Hier!“
Schweißgebadet wacht sie auf, schüttelt sich, um dieses entsetzlich peinliche Gefühl loszuwerden, und beschließt, sich umgehend von den Partnerbörsen im Internet wieder abzumelden.
Vor jedem Verlassen der staubgrauen Wohnung macht sich Lioba sorgfältig zurecht. Lippenstift und Kleidung harmonieren, die Haare steckt sie in Ermangelung einer brauchbaren Frisur hoch und sprüht das Ganze gründlich fest. Sie will passabel rüberkommen, für den Fall, dass sie Robert begegnet. Obwohl – sie ist darüber hinweg. Längst schon. Aber ihm begegnen? Zu ihrem Glück blieb ihr das bislang erspart.
Eigentlich war sie zunächst fest entschlossen gewesen, nicht aktiv eine neue Beziehung aufzuspüren. Entweder so etwas ergab sich von selbst oder eben nicht und damit Basta. Aber nichts ergab sich von selbst. Gar nichts. Und irgendwann hat sie sich beschwatzen lassen, hat sich überwunden und das passende Portal herausgesucht. Sie hakte ab, füllte aus, machte mit der tausendsten Formulierungsvariante, die ihr am wenigsten peinlich war, für sich Werbung und kam sich vor wie eine Nutte. Dafür konnte Mann nun über sie, ihr Alter, ihre Größe, Statur, Haarfarbe, Gewicht, Bildung, Anhängsel wie Kinder oder pflegebedürftige Eltern - in Fachkreisen auch Altlasten genannt - und Vorlieben nachlesen.
Partnersuche online in bildungsnahen Kreisen kostete natürlich einiges. Und die Fotografin war auch nicht umsonst, verstand aber immerhin ihr Handwerk, denn auf den Bildern lächelte eine dezent geschminkte, optimistisch dreinblickende, jung gebliebene Frau verheißungsvoll über ihre linke Schulter. Die müden Augen und den etwas faltigen Zug um den Mund hatte die Fotografin mit den Worten Das mach ich Ihnen ruckzuck weg korrigiert. Dann folgten die online arrangierten Treffen aus dem für sie zusammengestellten Männersortiment im richtigen Leben.
Die einzige Ausnahme hätte gepasst. Jonathan spielte Klavier und hatte schlanke, große Hände. Pianistenhände. Seine Stimme war sanfter Akzent. Nach dem zweiten gemeinsamen Restaurantbesuch musizierten sie zusammen. Nicht in Liobas Notunterkunft mit diesem Stempel von Tristesse, sondern in seiner Wohnung. Schon wegen des Klaviers.
Er hatte offensichtlich aufgeräumt und es roch angenehm. Jonathan spielte gerne Grieg, kannte sogar Stücke aus Peer Gynt, und Lioba spielte die Melodie auf ihrer Geige mit. Sie war froh, dass er sie nicht drängte, obwohl er mit Sicherheit um seine Wirkung auf sie wusste. Die Hände sahen auf den Tasten schön aus. Sie versprachen die Art von Berührung, die sie mochte. Aber Tatsache war, dass er mehrere Angebote hatte und sie nicht seine erste Wahl war.
Читать дальше