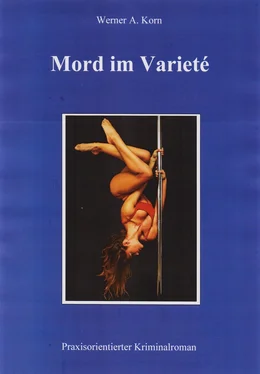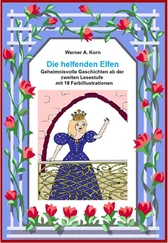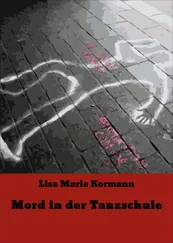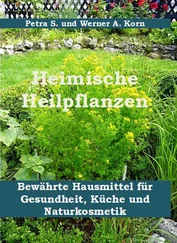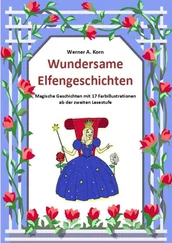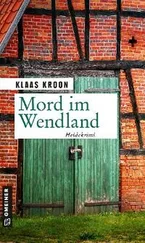Werner A Korn - Mord im Varieté
Здесь есть возможность читать онлайн «Werner A Korn - Mord im Varieté» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mord im Varieté
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mord im Varieté: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mord im Varieté»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mord im Varieté — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mord im Varieté», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Über den Köpfen der Gäste leuchteten von der dunkelblau bemalten, gewölbten Raumdecke gelb schimmernde, auf- und abschwellende, dem heimischen Nachthimmel nachgebildete Sternenbilder. Bei Auftritten bestrahlte eine bunt aufflammende Lichtshow die halbrunde Bühne.
Während sich an der Bar überwiegend das Trendgetränk ›Gin Tonic‹ einer großen Beliebtheit erfreute, frönten andere Cocktailfreunde nachhaltig dem Genuss von ›Mai Tai‹, ›Tequila Sunrise‹, ›Mojito‹ und ›Daiquiri‹.
5
Zu den Honoratioren in der Kreisstadt zählte auch die Familie des vor fünfzehn Jahren zugezogenen Spielwarenfabrikanten Burkhard Blauburger. Dieser hatte in drei Jahrzehnten seine Firma zu einem führenden Unternehmen in der Branche auf- und ausgebaut. Als 20-Jähriger war er einige Jahre als Handelsvertreter für namhafte Nürnberger Fabrikanten in der Spielwarenbranche unterwegs gewesen. In dieser Zeit schuf er sich enge Kontakte zu Einkäufern von größeren in- und ausländischen Großhandelsfirmen und zu Inhabern von etablierten Fachgeschäften. Damals erkannte der agile Außendienstler bald das zunehmende Interesse von Kindern an Cowboy- und Indianerutensilien. Er vertraute seiner Inspiration und setzte auf diese neue Marktentwicklung. Zusammen mit seiner Frau Martha, die eine Ausbildung als Schneiderin absolviert hatte, gründete er zunächst einen kleinen Betrieb zur Herstellung von Indianeranzügen, Squaw- und Cowboykostümen aus braunen Baumwollstoffen, sowie Pistolengürtel aus schwarzem Kunstleder mit einem oder zwei Holster für Kinder bis zu 14 Jahren. 15 fleißige Heimarbeiterinnen nähten die von Frau Blauburger in unterschiedlichen Größen zurechtgeschnittenen Teile zusammen. Bereits nach einem Jahr erweiterte man das Angebot mit mehrfarbigem Federschmuck, farbig bedruckten Kunststoffzelten, bunt bemalten Tomahawks aus Holz, sowie Bögen, Pfeile und Köcher aus braunem Kunstleder.
Schon nach wenigen Jahren erzielte Burkhard Blauburger einen geschäftlichen Aufschwung. Dass er ein großes erfinderisches Talent hatte, zeigte sich schon bald. Er entwickelte eine elektrische Zickzack-Schneidemaschine, mit der sich aus dünnen acht Millimeter breiten und gerade geschnittenen, schwarzen Kunstlederstreifen Zackenlitzen anfertigen ließen. Diese zierten als Bordüre die mit einem goldfarbigen Sheriffstern bestückten Cowboywesten. Die jährliche Produktpräsentation auf der ›Internationalen Spielwarenmesse‹ in Nürnberg führte zu einer hohen Umsatzsteigerung und ließ seine Firma zu einem Marktführer in dieser Branche aufsteigen.
Nachdem Sohn Benno, das Abitur am ›Neuen Gymnasium‹ in der Stadt geschafft hatte, absolvierte er bei einem langjährigen Freund seines Vaters eine dreijährige Ausbildung als Steuerfachangestellter. Da der Notendurchschnitt seines Zeugnisses lediglich ein mittelmäßiges Ergebnis aufwies, und er an einem Studium ohnehin kein Interesse zeigte, nahm er diese Empfehlung seines Vaters widerspruchslos an. ›Zahlen waren schon immer mein Ding!‹, dachte er dazu überschwänglich. Dabei bezog sich das weniger auf die Mathematik als Unterrichtsfach; vielmehr an das Bezahlen in Kneipen. Hierbei beglich er ebenso die Rechnungen seiner von ihm großspurig eingeladenen Zechkumpanen.
Burkhard Blauburger hatte jedoch bei der Berufsentscheidung für seinen Sohn Benno vielmehr dessen spätere Firmenübernahme und eine erfolgreiche Weiterführung des Betriebs im Blickfeld.
»Nur wer sich in Steuersachen gut auskennt, hat seine Nase immer vorn!«, war eine häufig ausgesprochene Redewendung des Firmenchefs, wobei er nicht nur seine Stimme, sondern auch schulmeisterlich seine rechte Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger anhob. Dabei blickte er sein Gegenüber mit seinem, seitlich nach vorne geneigten, Kopf prüfend an. Das war stets seine markante Geste, keinerlei Widersprüche an seinen Äußerungen zu dulden.
6
Die Schülerin Waltraud Weininger schaffte mit ihrem guten Notendurchschnitt problemlos den Übertritt in die Realschule. Nach dem erfolgreichen Abschluss vermittelte ihr Onkel Max eine verkürzte Ausbildungszeit zur Einzelhandelskauffrau in einem großen Discounter.
Da sie sehr sportbegeistert war, finanzierte ihr der Onkel die Mitgliedschaft in einem stadtbekannten
Fitness- und Wellnessclub.
Schon nach wenigen Monaten erklärte sie zu seiner großen Überraschung: »Ich bin dir sicher für alles sehr dankbar. Ich will aber den Kunden, die wohl aus Eitelkeit die Brille zuhause liegen ließen, nicht mehr ihre auf einem Einkaufszettel hingekritzelten Artikeln aus den Regalen heraussuchen müssen.«
Weil sie sich schon wiederholt etwas ruppig verhielt, besprach Onkel Max ihr Verhalten mit seiner Frau Rita. Diese meinte dazu: »Das wird sich schon wieder legen. In ihrem Alter spielen halt die Hormone gelegentlich ein wenig verrückt!«
Beide hatten mit Spätpubertierenden bisher keinerlei Erfahrungen gemacht. So beschlossen sie, darüber mit Waltrauds Eltern nicht weiter zu sprechen.
Ob die Jugendliche tatsächlich weiterhin ihre begonnene Ausbildung mit Ausdauer und Freude fortsetzen würde, blieb für beide eine offene Frage. Was in Waltrauds Kopf umherging, verriet sie noch nicht.
7
Einer der großzügigen Spender in der Kreisstadt Fasenau war der Metzgermeister, Gastwirt und Hotelier Hans Hofner, von seinen Stammtischbrüdern ›Da Insa‹ genannt. Der gebürtige Tiroler hatte vor Jahren als Metzgergeselle bei Albert Stolzer, dem Eigentümer des Gasthofes ›Zum Schmiedwirt‹ und eines Schlachtbetriebes, eine Anstellung gefunden.
Um das Jahr 1480 war die ehemalige Schmiede nach einem Umbau zu einer ›Tafernwirtschaft‹ umgewandelt worden. Seither trug dieser inzwischen traditionelle Gasthof, der sich mit seiner bayerischen Küche weit über den Landkreis hinaus einen guten Namen gemacht hatte, die Bezeichnung ›Zum Schmiedwirt‹.
Taferne, Taverne (von lat. taberna: Hütte/ Laden/ (Schau)-bude/Gasthaus, dann auch taberna publica) oder Tafernwirtschaft bzw. Tavernwirtschaft sind alte Bezeichnungen für eine Gaststätte. Der Wirt einer Taferne oder Tafernwirtschaft, Taferner oder Tafernwirt genannt, hatte in früheren Zeiten das Tafernrecht inne. Dieses Recht ist in etwa mit dem der heutigen Gaststättenkonzession vergleichbar. Es wurde vom Landesherrn verliehen.
Danach hatte der Wirt einer sogenannten „vollkommenen Wirtschaft“, nicht nur das öffentliche Schank- bzw. Krugrecht, das Herbergs- und Gastrecht sowie die Fremdenstallung (die Versorgung und das Unterstellen der Zug- und Reittiere), sondern er durfte auch Verlöbnismähler (Häftlwein), Hochzeiten, Stuhlfeste, Tauf- und sonstige festliche Mähler ausrichten. Der Wirt durfte Bier, Wein und Branntwein aus-schenken. Mit Wein wurden früher Rechtsgeschäfte betrunken. Daran erinnert heute noch der Weinkelch im Zunftschild. Zum Tafernrecht gehörte auch das Braurecht, das Brennrecht und die Backgerechtigkeit, also das Recht, einen Backofen anzulegen und Brot zu backen. Ein Tafernwirt musste zusätzlich wandernde Handwerksgesellen gegen Geld oder handwerkliche Gegenleistungen beherbergen. Er hatte also eine soziale Verpflichtung. Ferner wurde bei Todesfällen der Leichenschmaus in der Taferne abgehalten sowie die Nachlassverhandlung geführt. War kein Amtshaus vorhanden, fanden dort auch Gerichtsverhandlungen statt. Somit war die Taferne der kommunale Mittelpunkt in weltlichen Angelegenheiten der Bewohner des Dorfes.
Wenige Wochen nach seinem Arbeitsbeginn folgte Hans Hofner der Empfehlung seines Lehrherrn und schloss sich der Fußballabteilung des TSV Fasenau an. Nach einigen Monaten war er in diesem Verein der erfolgreichste Stürmer und treffsicherste Torschütze. Damit fand er bei den Fußballfreunden und -spielern sehr schnell Anerkennung und bei einigen langhaarigen Stadtschönheiten große Bewunderung.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mord im Varieté»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mord im Varieté» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mord im Varieté» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.