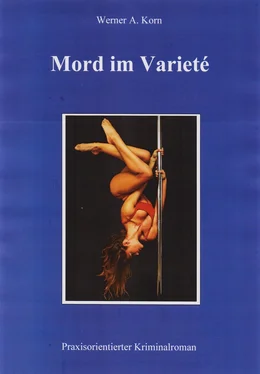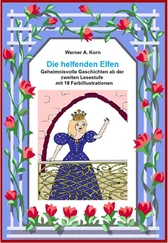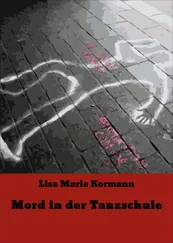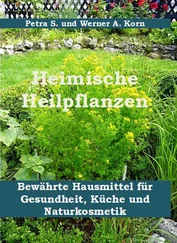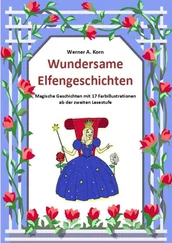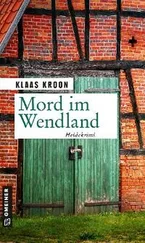Werner A Korn - Mord im Varieté
Здесь есть возможность читать онлайн «Werner A Korn - Mord im Varieté» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mord im Varieté
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mord im Varieté: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mord im Varieté»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mord im Varieté — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mord im Varieté», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das ›Fleischpflanzerl‹ hat viele Namen. Was man in Altbayern ›Fleischpflanzerl‹ nennt, wird in Nordbayern als ›Fleischküchle‹ oder ›Fleischküchla‹, in Berlin als ›Bulette‹, in Niedersachsen als ›Frikadelle‹ und in Südthüringen als ›Hackhuller‹ bezeichnet. Die ›Buletten‹ sollen von den aus Frankreich geflüchteten Hugenotten im 17. Jahrhundert nach Berlin gekommen sein.
Der Name ›Fleischpflanzerl‹ stammt von dem altertümlichen Wort ›Fleischpfannzeltel‹. Als Zelte bezeichnete man flache Kuchen, die aus Fleisch in der Pfanne zubereitet wurden. Diese Zubereitung besteht für die ›Fleischpflanzerln‹ weiterhin unverändert. Der Begriff Lebzelten hat sich für Lebkuchen bis heute erhalten. Während früher das ›Fleischpflanzerl‹ meiste aus Fleischresten gebraten wurde, wird heute eine frisch zubereitete Mischung aus Schweine- und Rinderhack verwendet.
Der Lebzelter war früher ein Lebkuchenbäcker, der u.a. Lebzelten (Lebkuchen) herstellte. Eine Verbindung zu dem Wort ›Fleischpflanzerl‹ ist dabei jedoch nicht erkennbar. Aus dem ehemaligen Begriff ›Pfann(en)zeltel‹ entstand zunächst die gekürzte Form ›Pfanzl‹, später ›Pflanzl‹ und durch das Braten mit der Fleischmischung das ›Fleischpflanzerl‹.
› Obazda‹ (auch ›Obatzter‹ geschrieben) heißt so, weil er mit den Händen gemanscht wird. Denn das bayerische Wort bedeutet nichts anderes, als Angebatzter oder Angedrückter. Es handelt sich dabei übrigens um ein Käsegericht, das hauptsächlich aus reifem Camembert, Butter und Gewürzen besteht.
In Franken wird er als ›Gerupfter‹ bezeichnet. Dieses würzige Käsegericht ist aus keinem bayerischen Biergarten mehr wegzudenken.
Denn, ob Bayer oder Preiß (= Preuße, für den Bayern alle Nichtbayern), zur zünftigen Maß Bier gehört auch eine deftige Brotzeit. Auch wenn der ›Obazde‹ sich mittlerweile zur bayerischen Spezialität gemausert hat, wurde er aus der Not heraus geboren, den überreifen Weichkäse noch irgendwie zu verwerten.
Ein alter Camembert oder Brie schmeckt ziemlich kräftig (der Bayer sagt dazu ›rass‹) und das ist schließlich nicht jedermanns Geschmack. Mit Butter abgemildert und mit Paprikapulver gewürzt, wird jedoch aus dem ungeliebten Weißschimmelkäse, der mit seinem Gestank schon den Kühlschrank verpestet, ein Schmankerl.
Je nachdem wie reif also der Weichkäse ist, umso ›rasser‹ schmeckt auch der ›Obazde‹. Wer es für den Anfang lieber etwas milder probieren möchten, sollte darauf achten, dass der Camembert noch nicht ganz so alt ist. Aber auch mit der zugefügten Buttermenge lässt sich die Schärfe regulieren. Der echte ›Obazde‹ sollte mindestens 50 Prozent Käseanteil aufweisen.
Seit Mitte 2015 sind die Bezeichnungen ›Obazda‹ und ›Obatzter‹ geschützt: Nur wenn die Käsespezialität in Bayern zubereitet wird, darf sie einen dieser beiden Namen tragen. Wer somit in Berlin das tolle ›Obazda-Rezept‹ nachkocht, erhält noch lange keinen ›Obazden‹, sondern lediglich einen ›ogmachten Kas‹ (= angemachten Käse).
Seine ihm nachfolgenden Freunde blieben kurz stehen und bestätigten mit einem kurzen Kopfnicken erwartungsvoll ihre Vorfreude. Joachim Jarisch, der 55-jährige Witwer erwiderte tief nach Luft schnappend: »Es ist zwar etwas anstrengend, aber so ein ›Johannisfeuer‹ erlebt man halt nicht jeden Tag.«
»Und das ist gut so!«, ergänzte Rudi Reiser kurz und bündig. Er liebte es, ohne große Reden mit anderen, still in sich gekehrt und in alle Ruhe die Natur zu genießen. Ruckartig zog er den rechten Schultergurt seines Rucksackes, der ihm von seiner schmalen Schulter etwas herabgerutscht war, wieder hoch.
Schweigend und gleichmäßig atmete die Gruppe die modrig-würzige Waldluft ein. Im Gleichschritt stapften die Männer weiter.
2
In der Kreisstadt Fasenau lebten, wie die Erhebung der letzten Volkszählung ergeben hatte, 87 342 Einwohner. Zum dritten Mal leitete Hans Habermann, der aus einer äußerst christlichen Großbauernfamilie stammte, als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt. Nach der Erbbrauchverordnung, dem allgemeinen regionalen Recht für die landwirtschaftlichen Betriebe, galt das Hoferbrecht des Ältesten. Daher hatte sein erstgeborener Bruder Josef den über 300 Jahre alten Hof einmal zu übernehmen. Hans Habermann begann nach der Fachhochschulreife seine Beamtenlaufbahn beim Finanzamt in Fasenau. Während seiner Beamtenzeit wurde er bis zum jüngsten Oberinspektor befördert. Durch sein Engagement im Vorstand der in Bayern jahrzehntelang staatstragenden Partei mit den christlich-sozialen Grundsätzen, folgte er einer Berufung zum Kämmerer der Kreisstadt Fasenau. Einige Jahre später erreichte er mit seiner Wahl zum hauptberuflichen Oberbürgermeister eine wesentlich höhere Beamtenposition.
Schon als jungen Beamten verheiratete ihn sein Vater
mit Eva Ehrfeldner, der jüngsten Tochter des weit über die Stadtgrenze hinaus bekannten Bäcker- und Konditormeisters Erich Ehrfeldner. Dieser war Inhaber sowie Leiter einer Großbäckerei und -konditorei mit 65 Mitarbeitern, die überwiegend ihre Ausbildung in dem Betrieb absolviert hatten. Täglich wurden im Umkreis von 50 Kilometern 37 Filialen mit Frischware beliefert. In den Großbetrieb hatte er seinen unverheirateten Sohn Erwin, der einmal alles weiterführen sollte, eingebunden.
Zum Familienbesitz zählte in der Stadt auch ein vierstöckiges Wohngebäude mit einer Verkaufsniederlassung und dem Stadtcafé ›Zur schönen Kuni‹ am Maxplatz. Erich Ehrfeldner hatte das alte Anwesen - es stammte aus den 30iger Jahren - in den 60iger Jahren erworben. »Leider viel zu teuer gekauft und dann viel zu aufwendig renoviert«, äußerte er gelegentlich sich selbst etwas bedauernd im privaten Kreis. Vor seinem Hauskauf betrieben in den dort gemieteten Räumen im Parterre schon seine Eltern das Café, benannt nach dem Stadtplatz als ›Max-Café‹. Den neuen Namen für das Café hatte seine Mutter Kunigunde Ehrfeldner kreiert. Sie war nach Abschluss des Lyzeums auf den Redouten der Stadt eine häufig von jungen Männern umschwärmte, sehr elegante Erscheinung gewesen. Auf diesen traditionellen Ballfesten trafen sich damals in Kostümen und Masken verkleidete Damen und Herren aus den besseren Kreisen der Stadt. Sie vergnügten sich zu der spritzigen, rassigen und klassischen Tanz- und Tafelmusik eines Salonorchesters. Einige der tanzfreudigen Damen versteckten ihr Gesicht den ganzen Abend hinter einer fantasievollen Maske, die sie erst um Mitternacht abnahmen. Auf einem der saalfüllenden Ballabende kürte die örtliche Faschingsgilde Kunigunde Ehrfeldner zur Ballkönigin. Ein paar neidvolle Damen tuschelten dazu: »Diese Auszeichnung hat sie nur einer großzügigen Spende ihres Mannes zu verdanken.« Das ›Max-Café‹ wurde kurze Zeit später in das Café ›Zur schönen Kuni‹ unbenannt.
Vor einem Jahr erfolgte eine umfassende Reno-vierung und Erweiterung des mit altem Mobiliar ausgestatteten Tagescafés für 60 Gäste.
Seit der Eröffnung durch den in Fasenau beliebten Vater des heutigen Besitzers zählten viele Stammgäste aus der Stadt sowie eine betuchte Laufkundschaft zum Kundenkreis. Besonders ältere Herrschaften schätzten die hervorragenden Kuchen- und Tortenspezialitäten und das vielfältige Kaffeeangebot. Mit einem großen finanziellen Aufwand und viel Liebe zum Detail entstand ein stimmiges Ambiente. An den hellgrauen Wänden hingen Intarsienbilder, die in naturgetreuer und künstlerischer Vollendung von Blumengirlanden umrahmte historische Ansichten und Denkmäler aus der Stadt zeigten. Die antiken aus Messing gefertigten Wandstrahler bewirkten eine dezente Ausleuchtung dieser einmaligen Dekorationsstücke. Die Besucher saßen in gepolsterten, komfortablen Sesseln, Stühlen mit Armlehnen oder auf Eckbänken, bezogen mit bordeauxrotem Stoff, die selbst bei einem langzeitigen Aufenthalt ein bequemes Sitzgefühl vermittelten. Mit den kleinen Blumengebinden, die in geschliffenen Glasvasen auf den runden oder ovalen Marmortischen abgestellt waren, unterstrich die Familie Ehrfeldner ihre Wertschätzung gegenüber ihren Gästen. Das gedimmte Licht der Deckenbeleuchtung sowie die weißen, transparenten Fenstergardinen schufen zusammen mit den bodenlangen, ockerfarbenen Dekoschals und den grauweißen Bodenfliesen in Natursteinoptik eine behagliche Wohlfühlatmosphäre. Aus der gläsernen und formschönen Verkaufstheke wählten die Kunden ihre Spezialitäten an Gebäck, Kuchen oder Torten selbst aus.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mord im Varieté»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mord im Varieté» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mord im Varieté» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.